Ob in Salzburg, London, Frankfurt, Wien, Paris, Berlin oder New York – Christine Schäfer ist auf der ganzen Welt eine gefragte Sopranistin. Zuhause ist sie in Berlin, wo sie nicht nur studiert hat, sondern inzwischen auch selbst als Professorin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler unterrichtet. In der Hauptstadt singt sie auch regelmäßig an der Staatsoper im Schiller Theater, zur Zeit ist sie in Mozarts Le nozze di Figaro zu hören. Doch neben dem klassischen Repertoire hat Christine Schäfer vor allem ein besonderes Interesse an der Musik des 20. Jahrhunderts. Ihr Urteil über die Aufnahmen ist also nicht nur bei Mozart, sondern auch bei modernen Komponisten wie Berg und Messiaen das einer Expertin. Die große Bandbreite ihres Repertoires zeigt sich auch auf ihrer neuesten CD, die Werke von Händel bis Messiaen vereinigt. Zum Blind gehört treffen wir uns am Morgen nach einer Traviata-Vorstellung – um 9 Uhr, ihre beiden Kinder zwingen Christine Schäfer zum frühen Aufstehen. Sie sei noch etwas gerädert vom Vorabend, sagt sie, hört aber dann mit Vergnügen zu und kommentiert mal zur Musik, mal hinterher – und lacht dabei oft und fröhlich.
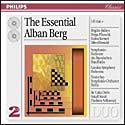
Berg: Lulu-Suite: Lulus Lied
Helga Pilarczyk (Sopran), London Symphony Orchestra, Antal Doráti (Leitung)
1961. aus: The Essential Alban Berg. Philips
Die Stimme kenne ich nicht. Aber das ist etwas Älteres, so ein Glissando darf man heute nicht mehr machen. Ich finde auch das Tempo ganz toll, flott und sehr unweich. Wenn man sich alte Aufnahmen anhört, ist man oft verblüfft, wie zackig und schnell vieles ist. Portamenti sind heute nicht beliebt – ich finde sie wunderbar. Gestern Abend in der Traviata war es supertoll, weil ich mit Omer Meir Wellber einen Dirigenten hatte, der zuhört und jedes kleine Detail mitbekommt. Das gibt es selten. Oft hat man wenig Freiheit auf der Bühne und muss arg aufpassen, dass man mit dem Orchester zusammen ist. Meine Theorie ist: Wenns wirklich schwierig wird, sind Portamenti die einzige Chance, mit dem Orchester zusammen zu sein, da geht man einfach schneller runter, und es passt wieder. (lacht) … Meine Schwester hatte einen Opernfimmel, als sie ein Teenager war, das war während der Ära Dohnányi in Frankfurt, wo Anja Silja die Lulu gesungen hat. Damals kam diese Musik zu uns ins Haus und hat mich sehr beeindruckt mit all ihrer Expressivität. Das tut sie bis heute, und diese Expressivität brauche ich auch in der Neuen Musik unbedingt, sonst macht sie für mich wenig Sinn. Deshalb ist Aribert Reimann für mich einer der führenden zeitgenössischen Komponisten.

Mozart: Le Nozze di Figaro.
Non so più cosa son, cosa faccio (Cherubino)
Agnes Baltsa (Sopran), Acedemy of St. Martin in the Fields, Neville Marriner (Leitung) 1985. Decca
Das ist sehr schön, und wunderschön in den Momenten, wo die Musik pausiert. Diese Freiräume nutzen sie hier hervorragend, und dass es die überhaupt gibt, ist das Verdienst des Dirigenten. Gerade bei Mozart und Händel sind die Dirigenten heute oft ein bisschen verbohrt – was mit der Alte-Musik-Szene zu tun hat. Man will historisch ganz korrekt sein und opfert dafür die Flexibilität und die Freiheit in der Musik, dabei ist Musik doch immer etwas Improvisiertes. Es gibt Leute, die sogar die Rezitative dirigieren – das hat mit Freiheit nichts zu tun. Man hat eine Generalpause, in der die Figur nachdenkt, das ist ein toller Moment – aber dann darf man ihn nicht auskosten, weil es heißt, das entspricht nicht dem Stil. Ich habe manchmal auch den Verdacht, dieses Stilargument ist ein Vorwand, um handwerkliche Probleme zu kaschieren. Flexibilität zu dirigieren, ist schwer. Die Frage, wer dirigiert, ist mir bei einem Engagement ganz wichtig. Es gibt Dirigenten, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeite. Mich stört einfach, wenn ein Dirigent dem Sänger nicht die Freiheit gibt, sondern seinen eigenen Kopf durchsetzen muss. Das ist keine Frage des Alters oder der Erfahrung, das ist eine Frage der Grundeinstellung. … Agnes Baltsa ist das? Ich hatte schon an sie gedacht, die Brüche in der Mittellage, wo sie manchmal mit zwei völlig verschiedenen Stimmen singt, sind typisch für sie. Aber ich hatte ihre Stimme viel dunkler in Erinnerung, ich habe sie nur live gehört.

Donizetti: Lucia di Lammermoor.
Il dolce suono (Wahnsinnsarie)
Beverly Sills (Sopran), London Symphony Orchestra, Thomas Schippers
1970. Westminster Legacy/Deutsche Grammophon
Auffällig ist dieses obertonreiche Singen. Im Orchester passiert ja wenig, und deshalb kann man so zart wie möglich singen. Dann steht die Farbigkeit der Stimme viel mehr im Vordergrund, das finde ich an den alten Aufnahmen besonders schön. Obertonreicher heißt: alles ein bisschen kleiner nehmen und der Resonanz des Kopfes vertrauen – und nicht versuchen, alles groß zu machen. Ich merke auch bei meinen Studenten, dass sie sich alle bemühen, laut zu singen. Und wenn sie dann versuchen, leise zu singen, gelingt das nicht, sie kommen gar nicht mehr an diese zarten Klänge. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich versucht habe, alles groß zu machen und die wärmeren, runden Klänge zu finden – das ging total nach hinten los. Man muss sich als Sängerin so annehmen, wie man ist, und darauf aufbauen.

Messiaen: Saint François d’Assise.
Dieu te donne sa paix (Engel)
Dawn Upshaw (Sopran), Hallé Orchestra, Kent Nagano (Leitung)
1998. Deutsche Grammophon
Da gibt’s doch nur die Einspielung mit Dawn Upshaw, oder? Das ist ein tolles Stück, gerade diese Szene hier ist so schön. Allerdings schwer zu inszenieren, das gebe ich zu. Und für einen konzertanten Abend viel zu lang. Messiaen ist schön zu singen. In der Traviata zum Beispiel ist die Arie im ersten Akt, wenn man alle Strophen macht, superanstrengend – der Rest macht Spaß, das ist tolle Musik, in die man sich reinlegen kann. Bei Mozart gibt es Stellen, wo ich denke, Hilfe, da muss ich gleich auch noch durch. Die Königin der Nacht zum Beispiel würde ich nie singen, selbst wenn ich diese hohen Töne hätte – das ist eine Zumutung. Die Wahnsinnsarie der Lucia dagegen ist ein Spaziergang, das glaubt man nicht. Das liegt einfach wunderbar, und da gibt’s Pausen, in denen man durchatmen kann. Doch, insgesamt macht‘s schon Spaß auf der Bühne. Wenn nur diese Nervosität nicht wäre, die ist unerträglich und wird immer schlimmer. Aber als ich den Messiaen in München gemacht habe, war ich sehr entspannt, und das tut einem Stück gut. Das ist überhaupt der Vorteil der Neuen Musik: Die kennt keiner, und niemand merkt, wenn man Fehler macht. Als Aribert Reimann bei uns an der Hochschule einen Kurs gegeben hat, war deutlich zu merken, dass viele Studenten im Konzert besser waren als bei den normalen Vortragsabenden – weil sie nicht unter diesem Druck standen: Jeder im Publikum kennt jeden Ton und weiß, wie es zu klingen hat – das ist hart. Wenn man sich bei Neuer Musik verhaut, merkt das niemand außer dem Komponisten. Und der ist meist froh, dass er überhaupt gespielt wird. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich von jemandem wie Aribert mitgenommen habe: Ich habe als Studentin seine Kinderlieder gesungen, die alle mit Metronomangaben versehen waren. Wir haben sie gemeinsam erarbeitet, und als wir über den Noten saßen, sagte er immer wieder: Was sind denn das für komische Tempi? Und er hat alle Metronomangaben geändert. Auch die Sieben frühen Lieder kann man mit den Metronomangaben gar nicht singen – ich weiß nicht, ob Berg nicht ein kaputtes Metronom hatte. Da bin ich stutzig geworden, was die historisch informierte Aufführungspraxis betrifft. Es ist eine Anmaßung zu behaupten, wir wüssten, wie es damals geklungen hat. Nehmen Sie die Dynamik: Der Hammerflügel war das erste Instrument, das eine stufenlose Dynamik erlaubt hat. Aber das Bedürfnis, laut und leise zu spielen, war doch bestimmt schon vorher da. Und selbst wenn nicht: Bei Händel singe ich einen verinnerlichten Moment leise. Ob das stilistisch richtig ist oder nicht, interessiert mich nicht die Bohne.

Wolf: Schlafendes Jesuskind
Elisabeth Schwarzkopf (Sopran), Wilhelm Furtwängler (Klavier)
1953. EMI Classics
Das ist Elisabeth Schwarzkopf, ganz eindeutig. Tataa! Die erkenne ich sofort. Meine Lehrerin hat mir immer gesagt: Hör dir bloß nicht die Schwarzkopf an! Dieses Gekaue auf den Vokalen, wo man nicht erkennt, was sie da eigentlich singt! Aber dieser obertonreiche Klang ist herrlich, und von der Phrasierung und der Musikalität her ist es super. Liederabende mache ich gern, da sind wir unsere eigenen Herren, das ist sehr persönlich, aber auch anstrengend. Bei Brahms und Strauss sind die Texte manchmal grenzwertig, aber da gibt es dann eben den sängerischen Moment, dass man Sachen machen kann, die man bei anderen Liedern nicht machen kann. Deswegen ist Schubert so toll, wenn er Goethe vertont… Mein Lieblingsstück aus der Winterreise? Das kann ich so nicht sagen. Aber machen Sie doch mal Die Krähe.

Schubert: Winterreise.
Die Krähe
Nataša Mirković-De Ro (Gesang), Matthias Loibner (Drehleier)
2010. Raumklang
Was ist denn das für ein Instrument? Der Leiermann spielt also schon von Anfang an. Ist das eine Sängerin oder eine Schauspielerin? Das ist ja noch mutiger als meine Aufnahme! Das ist das Tolle an der Winterreise. Es gibt Stücke, mit denen so etwas nicht funktionieren würde. Aber hier passt es, absolut. Und ich finde es sehr schön gesungen.



