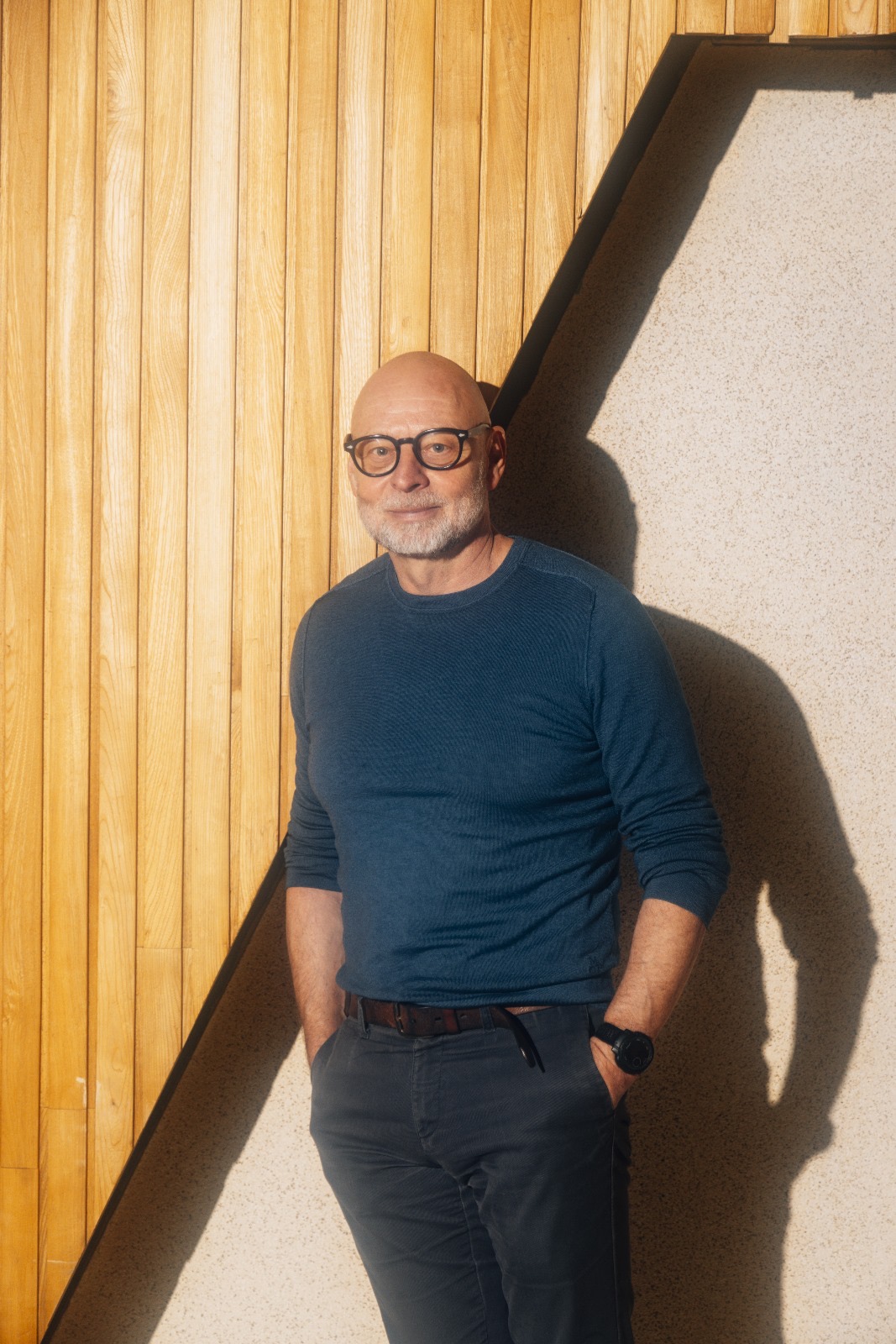„Ohne Musik keine Bildung“ – dieses Motto hat sich der Deutsche Musikrat auf die Fahnen geschrieben. Christian Höppner engagiert sich für das Thema, das er letztes Jahr zum bundesweiten Tag der Musik zusammen mit dem Konzerthaus Berlin, den Berliner Philharmonikern und anderen Partnern in den Fokus rückte.
Herr Höppner, welches Ziel hat die Kampagne „Ohne Musik keine Bildung“?
Wir wollen das Bewusstsein dafür stärken, dass musikalische Bildung unverzichtbar ist für unsere Gesellschaft, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und daraus müssen konkrete Angebote erwachsen. Dem Staat fehlt das Grundverständnis für die Notwendigkeit, jedem Kind über Kindergärten, Schulen und Musikschulen den Zugang zur Musik zu ermöglichen. Das wollen wir ändern.
Was unternehmen Sie, um dieses Ziel zu erreichen?
Wir führen Gespräche mit den politischen Entscheidungsträgern: mit der Kultusministerkonferenz, mit den zuständigen Fachministern in allen Bundesländern, mit dem Kulturstaatsminister Bernd Neumann und mit Bundestagsabgeordneten. Hier müssen stärkere Kooperationen zwischen den Ministerien stattfinden, die mit dem Bereich befasst sind. Es gibt bisher zu wenig Vernetzung, als dass der Bund wirklich neue Impulse setzen könnte.
Warum ist Musik für Kinder überhaupt so wichtig?
Musik kann ein Stück nicht fassbaren Glücks vermitteln. Ein Glück, das man nicht in Worte fassen kann. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, in der wir immer alles begründen und erklären wollen, ein besonders hohes Gut. Musik ist eine zwischenmenschliche Kommunikationsmöglichkeit, die durch kein anderes Medium zu ersetzen ist. Kein virtuelles Erlebnis ersetzt die Begegnung mit anderen Menschen, mit denen ich gemeinsam musiziere. Gerade in unserer Zeit der Digitalisierung brauchen wir diese fast archaische Form der Verständigung.
Wie sind Sie selbst als Kind mit Musik in Berührung gekommen?
Angeblich durch einen Brummkreisel. (lacht) Als Dreijähriger habe ich von selbst den Ton nachgesungen, den der macht. Und daraufhin beschloss meine Familie, dass ich musikalisch bin. Ich bin mit Musik aufgewachsen, meine Mutter spielt Cello, mein Vater Klavier, bei uns wurde samstags Hausmusik gemacht. Meine Eltern waren pädagogisch ganz geschickt: Wenn ich nicht zu viel ausgefressen hatte, durfte ich samstags abends länger aufbleiben. Und zuhören.
Also Musik statt Schokolade als Belohnung?
Genau, das war der Trick. Das Cello hat mich besonders fasziniert, das wollte ich lernen. Ich hatte das Glück in einer Kirchengemeinde aufzuwachsen, in der jeden Sonntag die passende Bach-Kantate gespielt wurde. Ich durfte gleich mitmachen, als ich das Cello gerade mal halten konnte. Dieses gemeinsame Musizieren von Anfang an war ganz wichtig. Bach steht für mich als Komponist auch heute noch im Zentrum. Das ist Musik, die unglaublich den Horizont weitet. Ich bin durch meine Kinder auf Musikstile gestoßen, bei denen ich früher gesagt hätte: bloß nicht!, aber ich finde mich da doch rein. Wobei ich zugeben muss, dass mich nichts wieder so gepackt hat wie Bach. Aber ich finde, es macht einen neugierig, wenn man mit Bach groß geworden ist.
Was wäre, wenn Sie die Musik nicht hätten?
Dann würde ich vertrocknen. Ich habe in meinem ganzen Leben Musik gemacht. Ich habe das Cello nur einmal für ein halbes Jahr nicht angefasst, da habe ich mich ganz schlecht gefühlt. (lacht) Das war, als ich frisch nach dem Studium Musikschulleiter wurde und von öffentlicher Verwaltung keine Ahnung hatte. Ein halbes Jahr lang habe ich mich nur darein gekniet. Und dann merkte meine Familie: Der ist nicht mehr er selbst, der verändert sich. Da habe ich mir geschworen: Das darf nicht wieder passieren! Ich nehme mehrmals die Woche das Instrument in die Hand, unterrichte an der Hochschule, spiele Kammermusik – der rote Faden Cello zieht sich durch mein ganzes Leben.
Haben Ihre Kinder auch mal gesagt, Papa, lass uns mit deinem Bach, wir wollen Hip Hop hören?
Ja klar, aber sie waren nie genervt von der klassischen Musik. Wir haben sie ihnen aber auch nie aufgedrängt oder erwartet, dass sie in unsere Fußstapfen treten. Das ist auch generell der Anspruch des Deutschen Musikrats – es geht auch in der musikalischen Bildung nicht darum, dass alle Profimusiker werden sollen, sondern dass die Scheuklappen geöffnet werden und Kinder neugierig werden und offen für Neues.
Sie sind durch Ihre Eltern mit Musik in Berührung gekommen. Wie können die Scheuklappen der Kinder geöffnet werden, die dieses Glück nicht haben?
Das fängt in den Kindergärten an und muss sich bis zur Ganztagsschule durchziehen. Und gerade bei den Kleinen muss der Qualitätsanspruch sehr hoch sein. Der andere Knackpunkt sind die Eltern: Wir müssen sie begeistern! Eltern überlegen oft nutzen-orientiert: Was braucht mein Kind später im Berufsleben? Soll es im Kindergarten Chinesisch lernen? Da verliert oft die musikalische Bildung, weil die Eltern selbst den Wert von Musik schon nicht mehr kennen gelernt haben.
Warum hat es Musik überhaupt schwer, ihren Wert zu behaupten?
Wir sitzen in einer selbstgebauten Verwertungsfalle. Wir haben über Jahrzehnte gesagt, Musik macht bessere Menschen, Musik macht klug und 1000 andere Dinge. Wir haben darüber den Wert der Musik klein geredet, den sie um ihrer selbst Willen hat. Der Anteil der Entscheidungs-träger, die sagen, Bildung ist Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, ist groß. Denen geht es um die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bildung. Dieser Blickwinkel hat seine Berechtigung. Aber wir brauchen auch die, die aus einem humanistischen Bildungsideal heraus sagen: Ich investiere in Bildung, ohne zu wissen, was am Ende dabei heraus kommt. Die Ökonomisierung der Bildung ist ein internationaler Trend, der der Musik im Weg steht.
In den letzten Jahren gab es einen Boom an Education-Angeboten von Orchestern und Opern. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Klasse – als Sahnehäubchen. Das darf jedoch nicht den Effekt haben, dass die Politik meint, der flächendeckende Musikunterricht sei nicht mehr notwendig. Das Publikum von morgen hervorzubringen werden die Orchester nicht alleine schaffen.
Wenn Education das Sahnehäubchen ist, was ist darunter?
Manchmal ist das ein Baiser – nur Luft. Die Torte unter der Sahne sollte eigentlich die musikalische Bildung in Kindergarten, Schule und Elternhaus sein. Aber da fehlt es in Berlin schon an ausreichend ausgebildeten Musiklehrern.
Glauben Sie, dass das Sahnehäubchen Appetit machen kann auf mehr?
Auf jeden Fall. Es kann zumindest neugierig machen. Bestenfalls kann es dazu führen, dass es so viel Lust weckt, dass ein Kind sogar die trägen Eltern davon überzeugt, dass es ein Instrument lernen möchte. Das habe ich selbst schon erlebt. Aber es bleibt eine Verzierung – die Torte ersetzt es nicht.