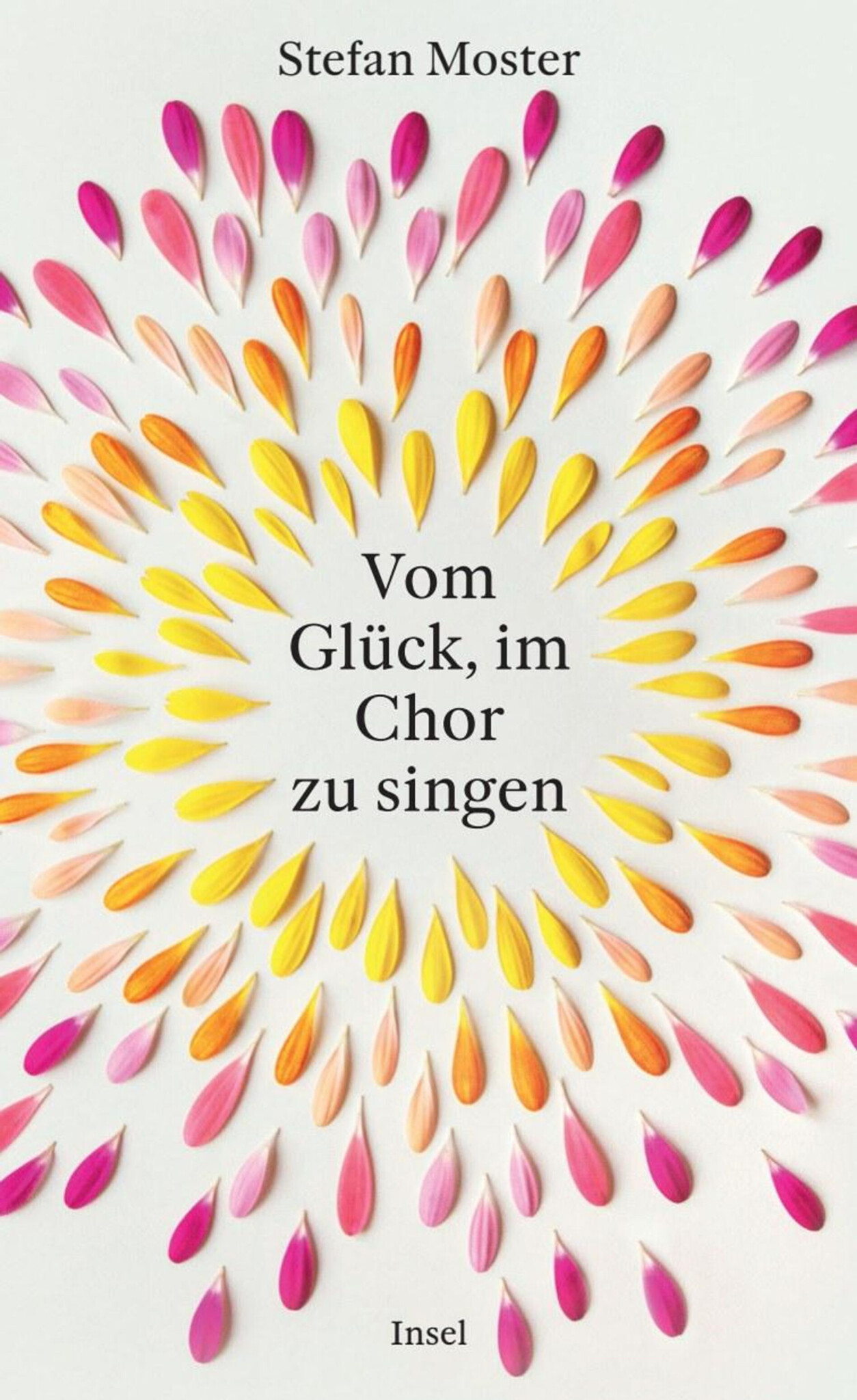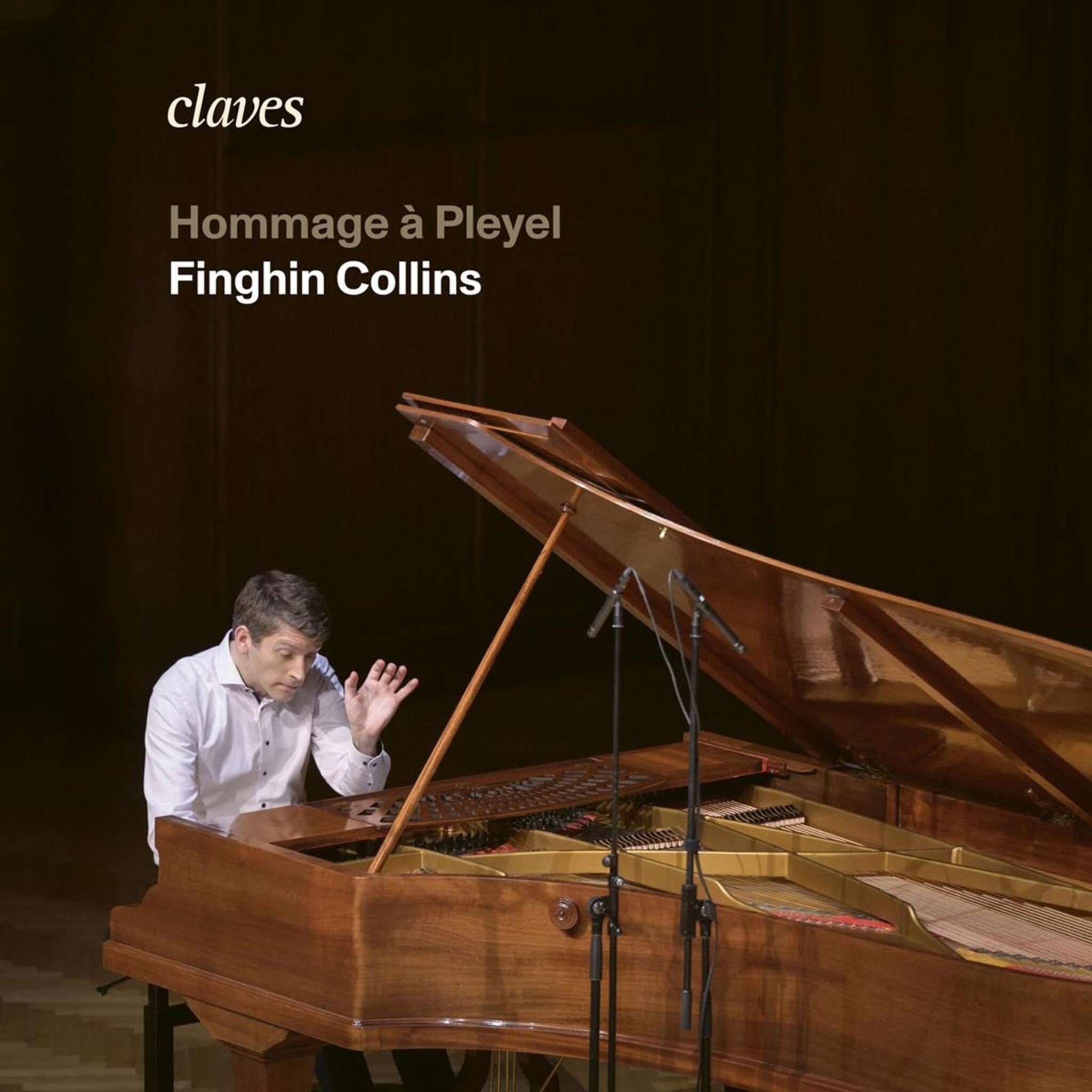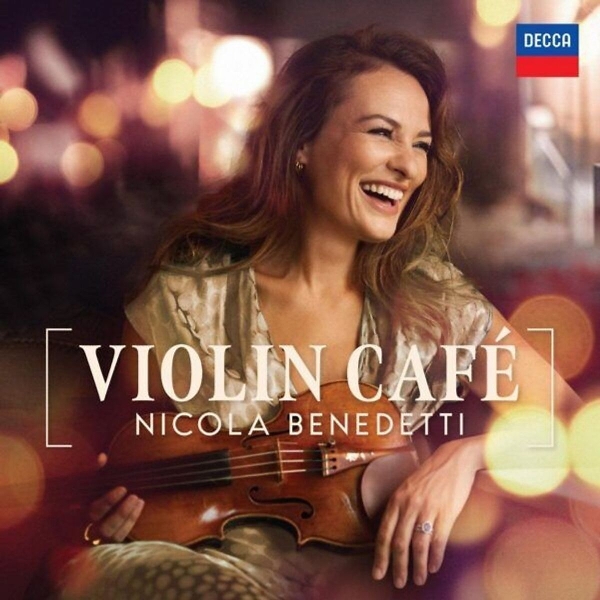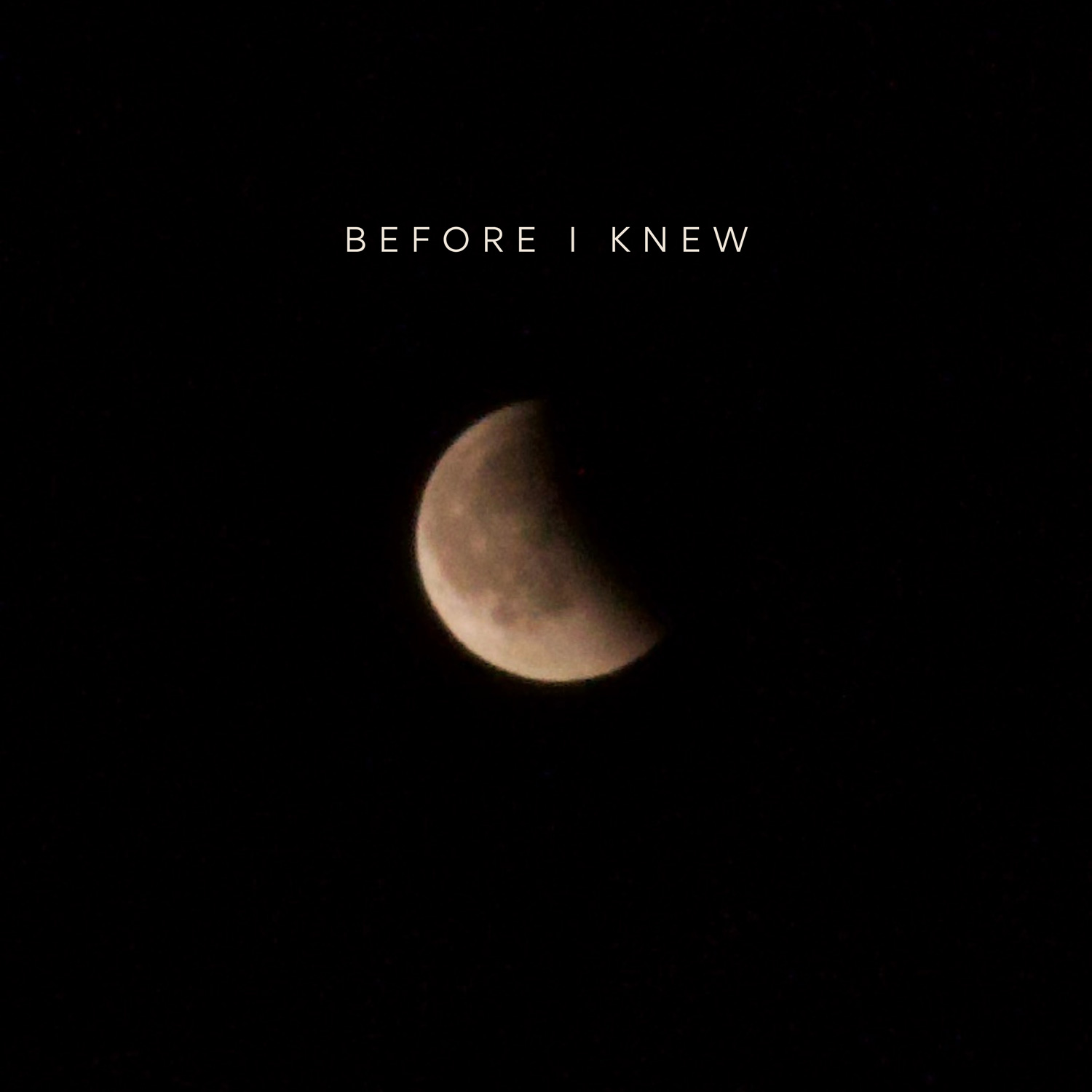Dass der Autor Stefan Moster sozusagen in eigener Betroffenheit geschrieben hat, wird beim Lesen unweigerlich deutlich: Er, der schon früh begann, Blockflöte, Gitarre, Oboe und Klavier zu spielen, gehört offensichtlich zu den vielen Menschen, denen ein Leben ohne Chor frei nach Loriot möglich, aber sinnlos erscheint. Und so leuchtet er aus, welche Vielfalt das Thema zu bieten hat. Er führt die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile an, die das Singen im Chor für das seelische wie körperliche Wohlbefinden des Einzelnen hat, er geht auf die jeweiligen Besonderheiten eines Knaben-, Mädchen-, Frauen- oder Männerchores ein, wobei er für letzteren eine Lanze bricht. Ausgangspunkt dieser Betrachtungen ist das Erlebnis des kleinen Jungen, dessen Großvater zu einem runden Geburtstag eine Ehrung durch beide Männergesangvereine des Ortes zuteil wird, was beim Enkel unauslöschliche Erinnerungen hinterlässt.
Der Autor verweist auf die Vielfalt von Chören, die im Gegensatz zum üblichen gemischten Kirchen- oder Konzertchor nicht verschiedenste Individuen zu einem homogenen Ganzen verschmelzen wollen, sondern gerade bestimmte Berufe oder Eigenschaften der Sänger und Sängerinnen in den Mittelpunkt stellen. Für beide Varianten führt Moster die entsprechenden gesellschaftlich relevanten Aspekte an. Darüberhinaus erklärt er, weshalb in Kirchen- oder kirchlich gebundenen Chören trotzdem so viele nichtgläubige Mitglieder zu finden sind.
Ergänzend spricht Moster immer wieder über einzelne große Chorwerke und erzählt von den wunderbaren Erfahrungen, die Sängerinnen und Sänger mit diesen machen können. Nicht ganz klar ist, an welche Adressaten der Autor gedacht hat: Leidenschaftliche Choristen werden nicht viel Neues aus diesem Buch erfahren, sich aber an vielen Stellen in ihrem Tun bestätigt finden. Aber ob jemand, den der Virus (noch) nicht infiziert hat, zu einem Buch mit dem Titel „Vom Glück, im Chor zu singen“ greifen wird?

Vom Glück, im Chor zu singen
Stefan Moster
Insel, 219 Seiten
20 Euro