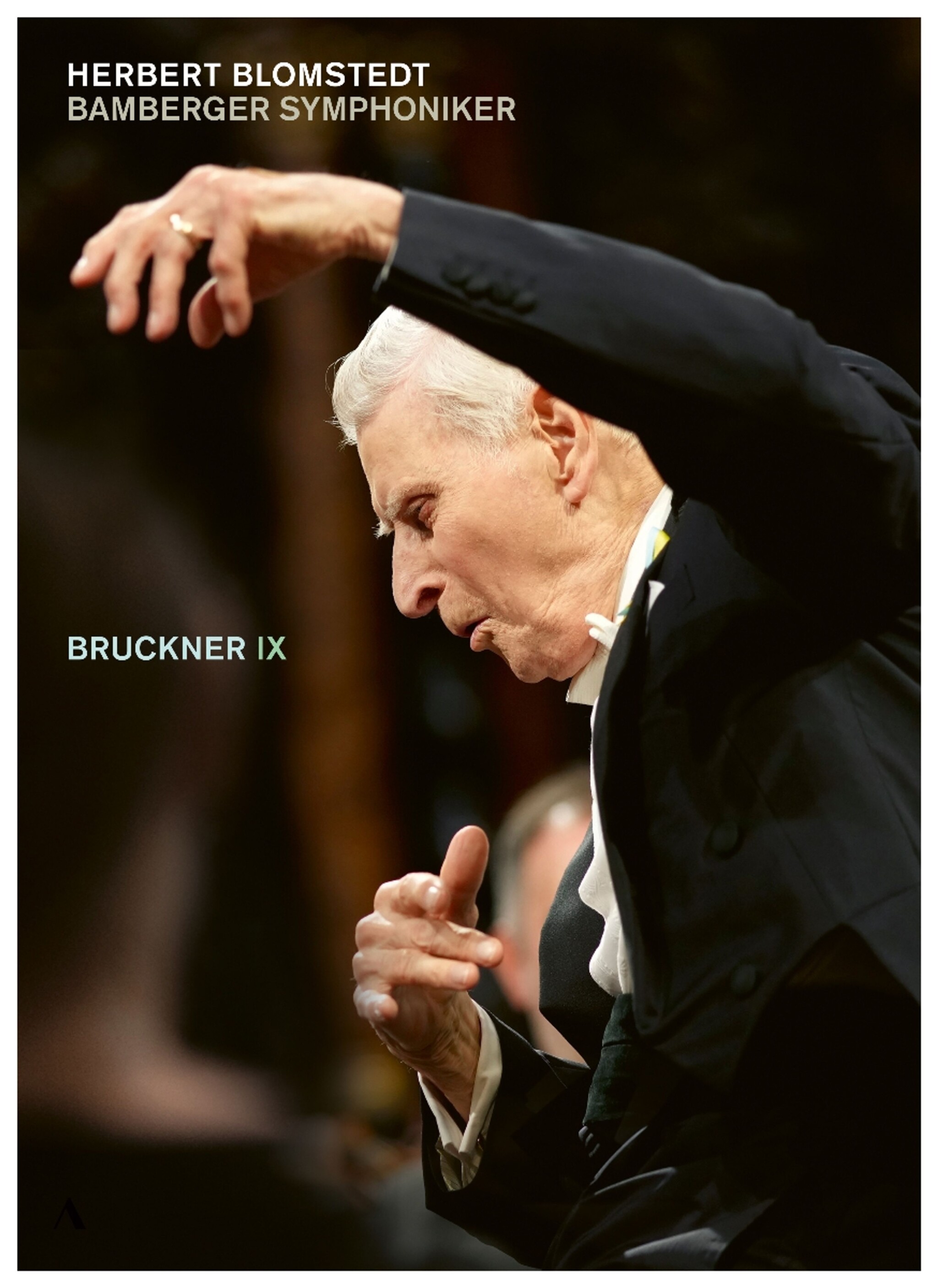Der Schwede Herbert Blomstedt, geboren 1927 in den USA, studierte u.a. Dirigieren an der Juilliard School und arbeitete dann als Assistent bei Igor Markewitsch und Leonard Bernstein. Mit dem Gewinn des Koussevitzky-Preises 1953 begann seine internationale Karriere, die ihn u.a. an die Spitze des San Francisco Symphony Orchestra führte. In Deutschland war er von 1975 bis 1985 als Kapellmeister der Staatskapelle Dresden und von 1998-2005 als Chef des Leipziger Gewandhausorchesters tätig.
Als einer der besten Bruckner-Dirigenten unserer Zeit wird er Anfang März mit dessen 5. Sinfonie, gespielt vom NDR Sinfonieorchester, in Hamburg und Kiel zu Gast sein.
Herr Blomstedt, Sie haben letztes Jahr die Leipziger Bach-Medaille bekommen – als erster Dirigent, der nicht aus der Szene der Alten Musik kommt. Hat Sie das überrascht?
Herbert Blomstedt: Es hat mich überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut. Es heißt zwar Bach-Medaille der Stadt Leipzig, aber man bekommt sie nicht nur für die Bach-Pflege. Es ist die höchste Musikauszeichnung der Stadt, und wenn die nur für Bach-Spezialisten wäre, wäre das etwas begrenzt.
Sie selbst haben sich aber schon früh sehr mit Bach befasst.
Blomstedt: Bevor ich Dirigent wurde, war ich Musikwissenschaftler und habe zwei Arbeiten über Bach geschrieben. Wir haben uns damals an der Universität Uppsala, wo ich studierte, viel mit Alter Musik beschäftigt. Das war noch bevor Nikolaus Harnoncourt mit seinem Concentus musicus anfing. Wir hatten schon in den 40er Jahren jedes Jahr Besuch vom Gambenquartett Basel unter der Leitung von August Wenzinger. Der war ein Pionier dieser Bewegung. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie er Marais, Gibbons oder Byrd gespielt hat: herrlich. Und als ich 1954 in der Stockholmer Philharmonie debütierte, fing mein Programm mit Bach an. Das war damals revolutionär – die „Bachausgaben“ waren ja nur verschiedene Arrangements mit ganz romantischen Bögen und Dynamik. Das musste ich alles ausradieren, damit der Urtext zum Vorschein kam.
Woher rührte Ihre Bachbegeisterung?
Blomstedt: Bach war von Anfang an mein musikalischer Leitstern. Schon als Gymnasiast spielte ich die Sonaten auswendig, das war meine Musik. Musik, die diesen Standard, dieses Ethos nicht hatte, war für mich nicht wert, dass man sich damit befasst. Wenn man jung ist, ist man ja wahnsinnig idealistisch. Damals konnte ich Musik von Franz Liszt nicht aushalten. Ich ging mit meinem Bruder ins Konzert, und als wir das Es-Dur-Klavierkonzert hörten, waren wir so voller Verachtung, dass wir das Stück „das Brechmittel“ genannt haben. Auch Mahler konnte ich nicht leiden, weil es dort so viele triviale und vulgäre Stellen gab. Was ist das gegen Bach, gegen die Beethoven-Quartette, das ist doch Straßenmusik! Da musste ich viel und lange heranreifen, um weitsichtiger zu werden. Aber die Endursache dieses scharfen Urteils war die enorme Bachbegeisterung.
Wie haben Sie Mahler dann später entdeckt – durchs Musikstudium?
Blomstedt: Nicht nur durchs Studium. Man muss sich damit befassen, es spielen, das muss ins Herz hinein. Es gibt in uns allen auch etwas Triviales – das Vulgäre ist auch menschlich. Als junger Mensch konnte ich das nicht ertragen im Vergleich zur reinen erhabenen Welt Bachs und Beethovens. Bei Mahler hat mir aber vor allem Außermusikalisches geholfen. In der DDR hat man ja sehr viel jiddische Literatur gedruckt, man wollte zeigen, dass man nicht judenfeindlich war. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt: Das ist Mahlers Welt. The Fiddler on the Roof – wenn der Geiger auf Hochzeiten und Beerdigungen spielt, weint er auf seiner Geige und alle weinen mit: Das ist Mahlers Musik. Da tat sich für mich ein Bild auf. Mahler hat seine ganze Welt porträtiert! Und plötzlich war seine Musik legitim für mich. Weil sie wahr ist.
Und Bruckner? Gehörte der für Sie von kleinauf zu den Großen?
Blomstedt: Bruckner haben wir sofort geschluckt, das war in derselben Klasse wie Bach und Beethoven. Meine erste Bruckner-Sinfonie habe ich mit dreizehn gehört, sie hat mich total begeistert und gefangen genommen. Ich ging mit meinem Bruder nach Hause und wir haben versucht, diese Melodien nachzupfeifen, damit wir sie nicht vergessen.
Dann hat Sie die Maßlosigkeit nicht gestört, die Bruckner immer vorgeworfen wird?
Blomstedt: Ich fand das nicht maßlos. Mahler ist maßlos, wenn er Riesenorchester verlangt, mit Kuhglocken und Hämmern. Bruckner verwendet das gleiche Orchester wie Beethoven, außer in den letzten drei Sinfonien, wo die Tuben hinzukommen. Und auch die Länge der Sinfonien ist gar nicht so enorm. Die meisten Bruckner-Sinfonien sind nicht länger als Beethovens Neunte. Die Achte ist sehr lang, aber da ist keine Note zuviel.
Mahler hat das anders gesehen, als er in die Partitur von Bruckners Fünfter schrieb: „Schade, aber es muss sein“ und 100 Takte strich.
Blomstedt: (lacht) Mahler hat ja auch in der Sechsten sehr viel gestrichen. Darüber können wir heute ein bisschen lächeln, aber das Ethos war damals ein ganz anderes. Für Mahler war das selbstverständlich. Er meinte, dass man auch mit seinen eigenen Werken so umgehen sollte: Wenn etwas nicht klappt, dann ändern Sie das. Wenn eine Klarinette weniger da ist, dann machen wirs eben mit fünf. Man ging damals viel freier um damit.
Einen ziemlich freien Umgang mit dem Notentext zeigten ja auch die verschiedenen Herausgeber der Bruckner-Sinfonien – wie arbeiten Sie mit den unterschiedlichen Fassungen?
Blomstedt: Das ist eine schwierige Frage. Nehmen Sie die siebte Sinfonie: In der Ausgabe von Haas stehen praktisch keine Tempoänderungen, während Novaks Fassung voll davon ist. Wir sind ja unter dem nüchternen Einfluss der 30er Jahre aufgewachsen, und nach unserem Ethos galt: Was nicht dasteht, soll man nicht machen. Und dann schreibt Novak im Finale der Siebten dieses immer wiederholte Ritardando im Thema. Ich wählte also früher die Haas-Ausgabe. Aber es gibt einen Brief Bruckners an Nikisch, der das Werk uraufgeführt hat. Und da schreibt Bruckner: „Es stehen in den Noten keine Tempomodifikationen, aber Sie, verehrter Meister, Sie machen das ja sowieso aus eigenem Empfinden.“ Er wollte es so. Das ist ja ein Problem aller Interpreten: Das Finale fällt ein bisschen ab nach diesem zweiten Satz, der den Höhepunkt des Werkes darstellt. Mit solchen Tempomodifikationen wird das Finale größer, imposanter, wichtiger. In den letzten Jahren bin ich daher zu Novak zurückgegangen.
Diese siebte Sinfonie Bruckners ist ja von Anfang an besonders populär gewesen – haben Sie eine Idee, warum?
Blomstedt: Die Themen sind einfacher, vor allem im ersten Satz. Das hat ja eine Wagnerische Breite und geht beinahe zwei Minuten. Auch wenn es meistens viel zu langsam gespielt wird. Das habe ich früher auch gemacht, weil ich Jochum sehr bewundert habe. Aber Bruckner hat es in der Erstausgabe metronomisiert, das ist viel schneller, als es Furtwängler oder Jochum gespielt haben. Und wenn Bruckner dann schreibt: ruhiger, dann werden alle schneller. Da habe ich radikal umgedacht.
Von der Achten spielen Sie aber eine Mischung aus zwei verschiedenen Bruckner-Fassungen.
Blomstedt: Ja, da bin ich nicht wissenschaftlich, sondern praktisch. Ich spiele immer diese Mischfassung der Achten. Aus rein musikalischen Gründen. Ich finde, das Ende des ersten Satzes ist in der zweiten Fassung viel besser. Wenn man die Erstfassung macht mit diesem triumphalen C-Dur-Ende, dann ist die Wirkung des Schlusses nicht so groß. Das hat Bruckner gesehen, und deshalb macht er in der zweiten Fassung das Ende des ersten Satzes viel kürzer und lässt es in Resigna¬tion schließen. Mit einem Frage- statt einem Ausrufungszeichen. Aber gleichzeitig hat er so viel gestrichen in dieser Fassung, dass die Proportionen nicht mehr stimmen, vor allem im zweiten Satz und im Finale. Deswegen verwende ich diese Mischfassung von Haas.
Wie gehen Sie mit der unvollendeten Neunten um?
Blomstedt: Ich spiele nur die ersten drei Sätze. Die Skizzen zu vervollständigen ist interessant. Aber man darf nicht vortäuschen, dass das Bruckner ist. Niemand weiß, wie Bruckner die Sinfonie zu Ende gebracht hätte. Ich höre mit dem langsamen Satz auf – wir empfinden es heute ja nicht mehr als Manko, wenn man mit einem langsamen Satz aufhört. Und Bruckners Vorschlag, das Te Deum zu spielen, ist keine gute Lösung – das passt stilistisch nicht so gut zusammen.
Sie können auf eine sehr lange Karriere zurückblicken – gibt es da so etwas wie ein ideales Konzerterlebnis?
Blomstedt: Perfekt ist es nie. Aber sehr oft ist man glücklich. Eigentlich bin ich das fast immer. Denn wenn etwas passiert, was nicht ideal ist, weiß ich meist, warum. Und das wirft einen versöhnlichen Schleier über die Fehler. Das gilt im Konzert, wo man voller Adrenalin steckt. Ganz anders ist es, wenn ich etwas danach noch mal höre, in einer Aufnahme. Dann bin ich meistens sehr unzufrieden mit mir. Dann höre ich nur Mankos.
Haben Sie alles dirigiert, was Sie wollten? Oder bleiben noch unerfüllte Wünsche?
Blomstedt: Es gibt so vieles, was ich gerne machen möchte. Ich habe nur zehn Hadyn-Sinfonien aufgeführt. Und hätte gerne noch wenigstens zwanzig gespielt. Ich würde gerne alle Haydn-Messen spielen. Mahler habe ich viel gemacht, aber nie die Siebte. Und von Bruckner nie die „Nullte“. Und dann gibt es noch viel wunderbare nordische Musik, die ich nie gemacht habe.
Sie haben noch Toscanini und Furtwängler bei der Arbeit erlebt – was kann man von denen heute lernen?
Blomstedt: Toscanini war ein virtuoser Dirigent. Er hat nur das Nötige gemacht, nie rumgefuchtelt. Und das wurde ein Feuerwerk. Aber wie hat er das gemacht? Ich würde mir wünschen, dass heute viel mehr von uns diese technische Beherrschung hätten. Furtwängler war dagegen kein guter Techniker, aber er hat immer bekommen, was er wollte. Seine Persönlichkeit war so stark, dass die Musiker erraten haben, was er wollte. Denn er konnte sich auch nicht so gut mit Worten ausdrücken. Er hat immer nur wiederholen lassen, ohne zu sagen, warum. Das hat man bei ihm akzeptiert. Für mich war er der größere Musiker. Toscanini war viel moderner, er hat den Notentext genauer beachtet. Seine Beethoven-Interpretationen haben etwas sehr Modernes – er war eher der Mendelssohn-Typ, Furtwängler der Wagner-Typ des Dirigenten. Aber am meisten habe ich Bruno Walter geschätzt. Der war menschlich vorbildlich, sehr kollegial, immer warm, mit viel Geduld und hat trotzdem immer erreicht, was er wollte. Ein nobler Herr am Pult.