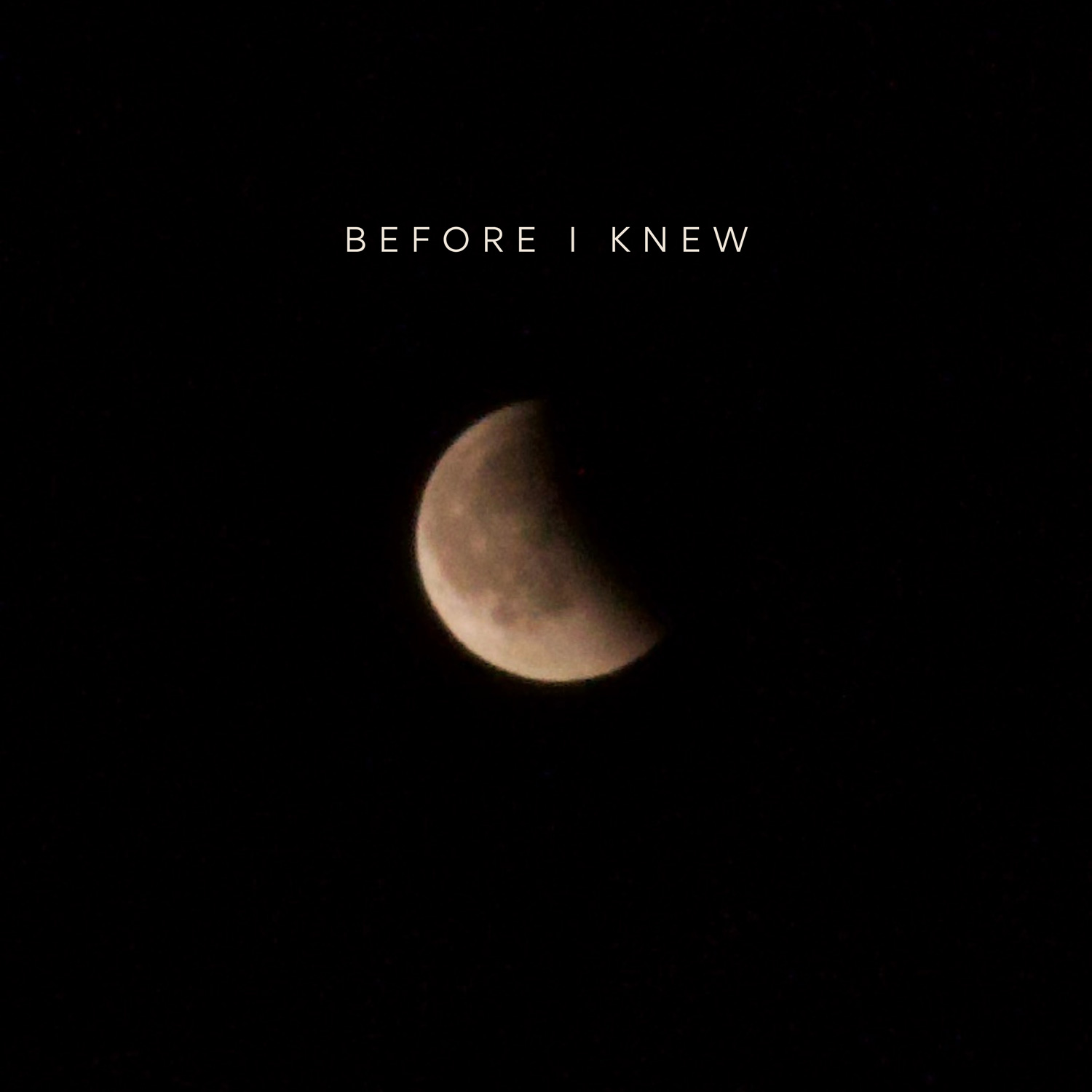Nachdem Arnold Schönbergs Zwölftontechnik sich als Sackgasse erwiesen hatte, wurde zeitgenössische Musik nur wirklich populär, wenn sie sich eklektizistisch oder neoklassizistisch gab. Oder wenn sie von Arvo Pärt komponiert wurde. Der vor 90 Jahren geborene Este hatte sich nach seinem Kompositionsstudium zunächst selbst an Zwölftonreihen und Serialismus versucht und damit den Unmut der sowjetischen Kulturfunktionäre zugezogen. Auch das frühe Hauptwerk „Credo“, mit dem der 37-jährig in die orthodoxe Kirche eingetretene Komponist trotz prompt folgender staatlicher Missbilligung ganz bewusst in die Pfade der geistlichen Musik einschwenkte, zeigte zwar seine späte Berufung auf, aber noch nicht den Weg dahin. Acht lange Jahre blieb es stumm in der Tallinner Komponierstube.
Die Stille zum Klingen bringen
Dann entstand, was Arvo Pärt so einzigartig macht: die Idee der geistlich aufgeladenen und damit nie angreifbaren Reduktion. Ob nun gregorianische Gesänge der Auslöser waren oder angeblich ein Straßenfeger, der forderte, jeden einzelnen Ton zu lieben – wie Arvo Pärt zur Erleuchtung kam, ist letztlich irrelevant. Denn was Schönberg nie schaffte, gelang Pärt mühelos: der bis heute erfolgreichste zeitgenössische Komponist zu sein, gar als Popstar gehandelt zu werden.
Den letzten Schub für diese Karriere gab die Ausweisung aus der Sowjetunion 1980 und die Neuansiedlung in Wien. Einige Monate später siedelte Pärt mit seiner Familie nach Berlin um und landete mit seiner 1984 erschienenen CD „Tabula Rasa“ einen Volltreffer, die im Westen schon deshalb erfolgreich war, weil sie mit Gidon Kremer ein weiterer Exil-Balte einspielte. Der aus dem säkularisierten Osten verbannte Komponist, der mit Rauschebart und Mönchsstirn am laufenden Band spirituell evozierte Musik produzierte, wurde fortan – ungewollt – zum Medienstar.

Glöckchen, Tabula rasa und Qigong
Ihr Erfolg lag im von Pärt selbst so genannten „Tintinnabuli-Stil“, übersetzt also der Glöckchen-Methode: Wie in einem Choral fanden einige wenige Stimmen in klarer, irgendwie als göttlich empfundener Ordnung zusammen, und das in einer Zeit, die komplexer wurde, schwer zu durchdringen und noch schwieriger zu verstehen. Daraus entwickelte Pärt zuerst einfache Dreiklänge, gern sehr lange mit- und übereinander ausgehalten, später verfeinert und ausdifferenziert.
All das wirkte wie eine Wohltat aus dem Qigong-Repertoire und prägt Arvo Pärts Kompositionsstil bis heute so entscheidend, dass seine Musik ab sofort wiedererkennbar blieb. In ihrer Simplizität wirkt sie fast so archaisch, dass manche sie gar trivial nennen mögen, aber diese Kritik greift zu kurz. Denn die geistliche Konnotation der meisten Werke enthebt die Musik nicht nur dem Vorwurf der Banalität. Ihr größter Wert ist vor allem die Wirkung, die sie beim Publikum auszulösen vermag: Man fühlt sich weniger berauscht als beseelt, mit Sinn erfüllt, zu den Wurzeln des Lebens geführt.
Arvo Pärts Ästhetik wirkt bis in seine greisen Tage allen aufgenötigten Kunstzwangs enthoben. Seine selbstgewählte Beschränkung ist wohl der Schlüssel zu einer Art Unendlichkeit.