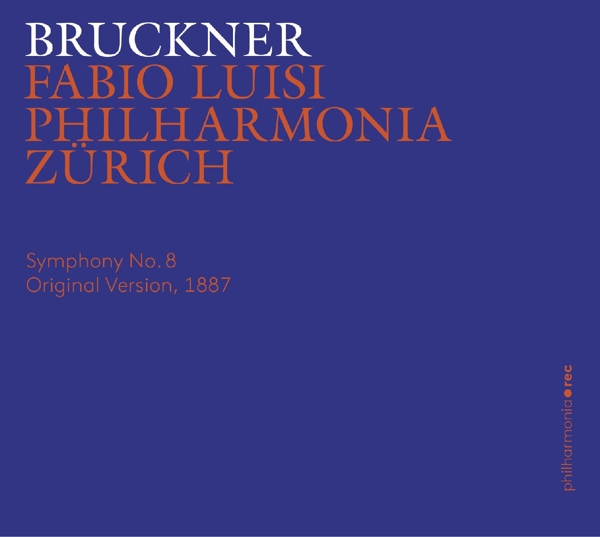Fabio Luisi kennt den Opernbetrieb wie kaum ein Zweiter in der Branche. Verbrachte der heutige Zürcher Generalmusikdirektor doch die ersten Jahre nach seinem Kapellmeister-Diplom an der Grazer Oper als „Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung“. Begleitete die Solisten am Klavier, probierte mit Luciano Pavarotti, arbeitete mit Plácido Domingo und Mirella Freni – und räumt im concerti-Gespräch gleich mit einem Klischee auf: „Die haben keine großen Allüren. Im Gegenteil: Je berühmter die Sänger sind, desto normaler sind sie. Das sind extrem professionelle Menschen, Arbeiter wie jeder andere auch. Diven habe ich nur sehr selten erlebt.“
Alle Welt kennt Sie als Dirigenten, doch Sie haben auch schon als Sänger auf der Bühne gestanden…
Richtig, das war 1981 in Martina Franca, wo ich beim dortigen Festival als Korrepetitor und Dirigent tätig war. Man hatte schlicht vergessen, eine ganz kleine Rolle zu besetzen, also bin ich eingesprungen.
In welcher Stimmlage?
Tenor, das war in Aubers Oper Fra Diavolo die Rolle eines Bauern, der zwei Sätze zu singen hat. Ich habe ein Kostüm und eine Perücke bekommen, der Leiter des Festivals Rodolfo Celletti hat mir noch eine sehr schnelle Gesangseinweisung gegeben, und dann habe ich das zwei oder drei Vorstellungen gesungen. Es wurde sogar auf Schallplatte verewigt.
Hat Ihnen diese Erfahrung später beim Umgang mit Opernsängern geholfen?
Nein, dafür war das eine zu kleine Rolle. Was mich viel mehr geprägt hat, war die tägliche Arbeit auf diesem Festival sowie am Grazer Opernhaus als Korrepetitor. Das war nicht nur das Begleiten der Sänger am Klavier, sondern da gab es auch noch viele andere Dinge zu tun. Ich habe Orgel gespielt, Cembalo, Celesta im Orchester, ich habe Einsätze gegeben, souffliert oder bei der Zauberflöte Trommel gespielt.
Das klingt nach einer guten Schule.
Ich könnte mir nicht vorstellen, heute zu dirigieren – vor allem nicht Oper –, wäre ich nicht durch diese Schule gegangen.
Der frühere Direktor der Wiener Staatsoper Ioan Holender meinte einmal, Sie gehörten
zu den Künstlern, „die durch langen, mühevollen Aufstieg zum Gipfel gelangten“. Haben Sie es als mühevoll empfunden?
Nein. Im Gegenteil, ich habe genossen, dass ich Zeit hatte, mich zu entwickeln. Mein Klavierdiplom habe ich mit 19 gemacht, erst da habe ich mit dem Dirigier-Studium begonnen. Nach meinem Kapellmeister-Diplom 1983 ging ich dann für vier Jahre an die Grazer Oper und arbeitete 14 Sommer lang beim Festival in Martina Franca. All die Dirigenten in meiner Generation wie Michael Boder, Roberto Abbado oder Marcello Viotti sind nicht schnell aufs Podium gekommen. Christian Thielemann zum Beispiel hat auch als Korrepetitor in Bayreuth gearbeitet. Aber das waren auch andere Zeiten, da gab es noch nicht diesen Jugendwahn.
Sie beobachten einen Jugendwahn im Dirigentenfach?
Ja, es werden heute viele junge Talente so lanciert, als wären sie mit 18 oder 19 Jahren schon fertig. Doch das können sie nicht sein, da brauchen wir uns nichts vormachen. Sie sind vielleicht begabt, aber so früh so gepusht zu werden, tut ihnen nicht gut, weil sie dann nicht die Zeit haben, sich zu entwickeln. Ich habe an der Mailänder Scala erst vor drei Jahren debütiert, da war ich schon über 50. Für mich war es das richtige Alter, mit 20 wäre ich noch nicht fertig gewesen für solch ein Orchester.
Ihr Kollege Franz Welser-Möst hat zu den jungen Kollegen angemerkt: „Technisch haben die alles drauf, doch sie wissen wenig über die Musik.“ Erleben Sie das auch so?
Absolut, weil Musik eben nichts ist, was man mit dem Taktstock einfach runterschlägt oder am Klavier runterdonnert. Sondern Musik ist zuerst einmal etwas, was man empfinden muss. Die Instrumente, die wir zur Verfügung haben, sind ein Medium, aber das allein macht noch lange nicht die Musik. Dass mein Orchester mit meinen Gästen synchron spielen kann, das ist nicht nur Dirigieren, sondern noch viel mehr. Vom Musikverständnis her gibt es unter den jungen Dirigenten nur wenige, die etwas zeigen können.
Sie und viele Ihrer Kollegen pendeln zwischen verschiedenen Häusern, Orchestern und Kontinenten. Muss ein Dirigent heute auch ein guter Manager sein?
Nicht unbedingt. Aber es hilft natürlich, um zu verstehen, was drumherum passiert. Die Figur des Dirigenten im Elfenbeinturm jedenfalls kann nicht mehr existieren. Es ist ein so großes Business geworden: Das Tempo, das die Kulturinstitutionen heute hinlegen müssen, ist enorm und nicht vergleichbar mit der Zeit, zu der ich angefangen habe. Da hat sich vieles radikal verändert.
Zu dem Drumherum gehören bekanntlich auch Streitigkeiten um Posten, wo man als Dirigent manchmal zwischen die Fronten von Politik und Kulturinstitutionen gerät.
Ich habe eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Für mich stand die Karriere aber auch nicht so im Vordergrund, mir war wichtiger, dass ich mit Orchestern und bei Institutionen arbeite, die mir gute Bedingungen bieten. Wo ich mit offenen Armen empfangen werde und wo ich eine gute Qualität vorfinde, als Basis für die künstlerische Arbeit.
Was ist denn für einen Generalmusikdirektor eine gute Vertragsdauer?
Gute Frage. Ich kenne einige Dirigenten, die mit großem Erfolg bei Orchestern begonnen haben, wo sich aber nach fünf, sechs Jahren das Verhältnis zu ihren Ungunsten wandelte. Ich denke, acht Jahre sind eine gute Zeit – und zehn Jahre sind wahrscheinlich die Obergrenze, um eine fruchtbare Zusammenarbeit und ein positives Arbeitsklima zu haben.
Warum wird es nach zehn Jahren schwierig?
Jeder von uns Dirigenten hat ja ganz bestimmte Fixpunkte, auf die er es bei der Arbeit anlegt, Dinge, die ihm wichtig sind. Und wenn es soweit ist, dass die Musiker im Orchester denken, „wir wissen jetzt schon ganz genau, was er sagen will“, bevor der Dirigent es ausgesprochen hat – dann ist das der Moment, wo man aufhören sollte.
In Ihrem Buch Erst der halbe Weg erklären Sie, wie der Marktwert eines Dirigenten in Deutschland von der Deutschen Opernkonferenz festgelegt wird.
Ja, nicht nur für Dirigenten legt die Opernkonferenz den Marktwert fest, sondern auch für die Sänger.
Und dieser Wert ist bindend für die Opernhäuser?
Er ist freiwillig bindend für die Institutionen, die der Deutschen Opernkonferenz angehören. Die Gagen werden dort besprochen und die Häuser halten sich daran, damit es keinen zu großen Konkurrenzkampf gibt. Es wäre ja unfair, wenn bei einem Spitzendirigenten die Bayerische Staatsoper mehr zahlt als etwa die Staatsoper Berlin.
Es geht also auch um eine Begrenzung nach oben?
Ja, das ist ähnlich wie bei der Metropolitan Opera in New York. Dort gibt es eine „Top-Fee“, die nicht überschritten wird. Es gibt für manche Künstler noch verschiedene Benefits, aber was die Abendgage betrifft, da verdiene ich im Prinzip genauso viel wie Frau Netrebko.
Herr Luisi, ich habe gelesen, dass Sie auch komponieren…
… ach so?
Sie kreieren Düfte für Ihre eigene Linie FL Parfums. Hat das nicht auch etwas von Komponieren?
Ja, es gibt Gemeinsamkeiten zum Komponieren, aber auch zum Dirigieren. Denn ein Dirigent muss die verschiedenen Farben des Orchesters so zusammenmischen, dass sie ein Gleichgewicht haben – und um dieses Gleichgewicht geht es auch, wenn ich ein Parfüm kreiere.
Wie viele Bestandteile hat so ein Parfüm?
Es kommt drauf an: Einfache Düfte haben 10 bis 15 verschiedene Komponenten, bei komplexeren Düften können es bis zu 100 Ingredienzen sein.
Sie selbst bieten auch maßgeschneiderte Parfüms an …
Richtig, ich habe ein paar Kunden, die ihr Parfüm bei mir nach ihren Wünschen kreieren lassen. Meistens lade ich sie dafür in mein Labor ein und lasse sie an den reinen Substanzen riechen. Sie sagen mir dann, was ihnen gefällt und beschreiben, wie sie sich ihr Parfüm vorstellen. Anhand dieser Informationen fange ich an, etwas zu mischen, zuerst etwas Einfaches mit sieben bis zehn Komponenten. Dann lasse ich sie nochmal riechen, woraufhin sie mir sagen: „Das ist zu bitter, zu viel Zitrone, zu süß, zu trocken …“ Dann korrigiere ich oder mache etwas Neues, bis wir den richtigen Duft gefunden haben. Das geht allerdings nicht in ein paar Stunden, sondern ist ein Prozess, der Monate dauert.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie zu Beginn eines Konzerts durch das Orchester laufen: Muss man sich das als große Duftwolke vorstellen, weil die Musiker sich alle unterschiedlich parfümieren?
Nein, so ist das nicht. Meistens wird im Opernhaus Wert darauf gelegt, dass man sich nicht allzu sehr parfümiert.
Warum?
Das geschieht vor allem aus Rücksicht auf die Sänger. Die Solisten müssen eine relativ duftneutrale Umgebung haben, damit sie nicht Allergien oder Irritationen entwickeln. Daher wird bei der Arbeit im Opernhaus weitestgehend auf Parfüm verzichtet. Wenn Sie also in die Garderoben gehen, werden Sie dort eher selten den Geruch von Parfüm in der Nase haben.