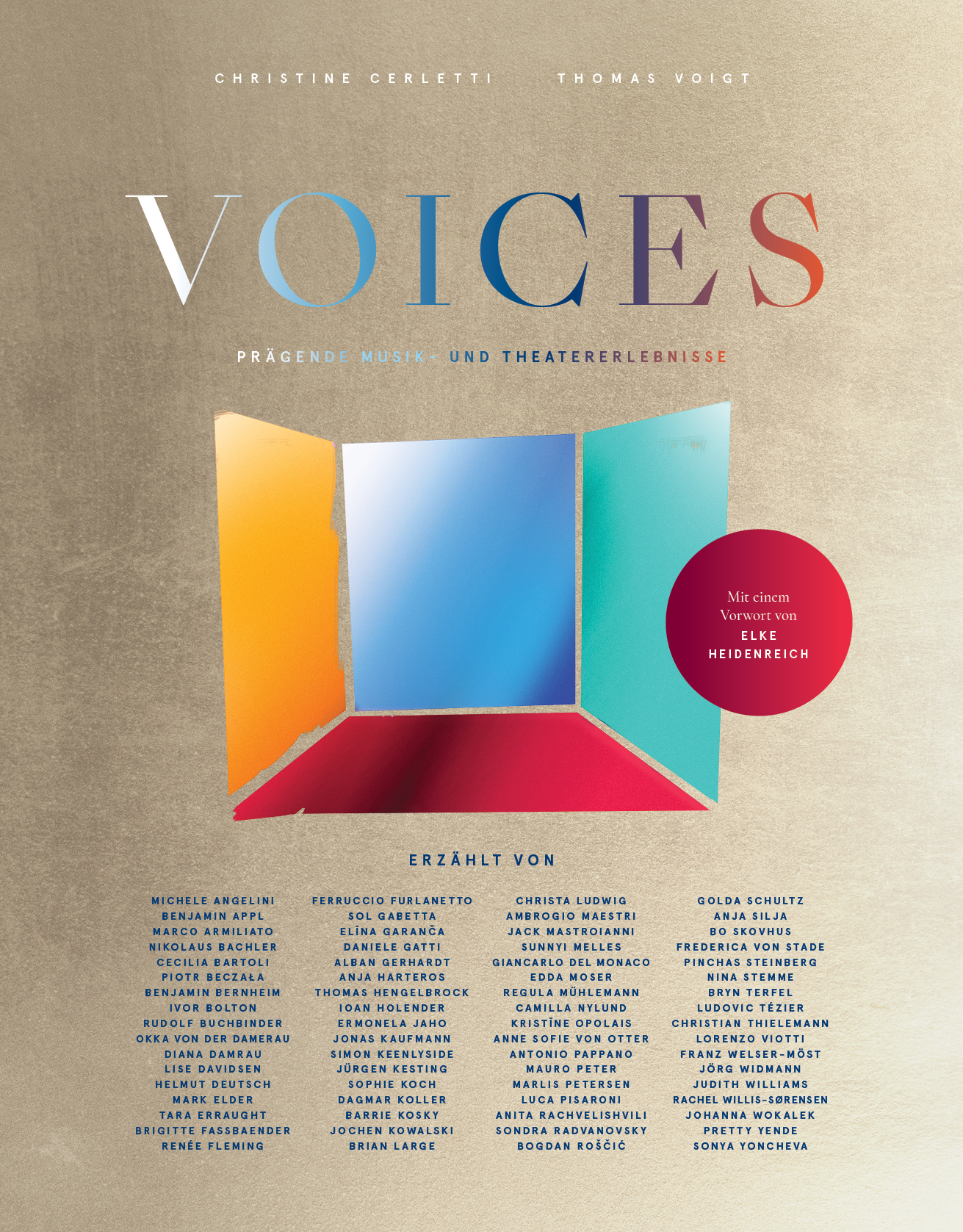Drei Tage vor unserem Gespräch titelt die Berliner Zeitung am Sonntag: „Aller guten Ringe sind acht“. Acht? Es geht um die Ringe an den Fingern von Barrie Kosky: Er trägt nicht mehr an jedem von ihnen einen Klunker – es sind weniger geworden. Da schaut man beim Berliner Boulevard schon genau hin. Meldungen wie diese zeigen, dass der Intendant der Komischen Oper Berlin innerhalb von zwei Jahren in der Hauptstadt zum Medienstar geworden ist.
Kaum zwei Wochen zuvor hat Barrie Kosky am Opernhaus in der Behrenstraße ein Stück angesetzt, das antiboulevardesker kaum sein könnte: Bernd Alois Zimmermanns Oper Die Soldaten. Ein dissonanter Aufschrei gegen das Unrecht dieser Welt, das blutige Fanal eines großen und verzweifelten Komponisten, eine Jahrhundertoper von epochalem künstlerischen Anspruch. Anstrengend fürs Ensemble, anstrengend fürs Publikum.
Nach erfolgreichem Ausgang wirbt das Haus sofort für die erste Operettenpremiere der neuen Saison: Die schöne Helena von Jacques Offenbach. Das Innerste, der schwierige Kern der Kunstform Oper einerseits – der Schein des Schönen, auch des Leichten, nach außen andererseits: Dass der Opern- und Theaterregisseur aus Melbourne dies nicht als Widerspruch empfindet, macht seine künstlerische Identität aus. Und die der Komischen Oper, spätestens seit Kosky vor zwei Jahren ihr Intendant wurde.
Nicht die Genre-Schublade, sondern die Qualität ist entscheidend
„Ich wähle meine Stücke nicht wegen ihres Genres aus irgendwelchen Schubladen aus, ich wähle sie wegen ihrer Qualität. Und Die schöne Helena ist nun mal eine der besten Operetten, die es gibt.“
Barrie Kosky sitzt auf einer schwarzen Couch zwischen Bücherstapeln in seinem spartanisch eingerichteten Büro. Er hat zwei harte Spielzeiten hinter sich, allein sechs Inszenierungen hat er selbst gemacht in Berlin, dazu zahlreiche Neueinstudierungen. Nach dem ersten Jahr wurde die Komische Oper in einer Kritikerumfrage zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt, nach dem zweiten dann konnte sie ihre Auslastung um satte zehn Prozent steigern. Dafür brauchte es mehr als nur einige neue Operetten im Programm – und der Erfolg war keineswegs von Anfang an gewiss.
„Unsere größte Sorge war, dass die Abkehr von rein deutschsprachigen Aufführungen schlecht ankommt. Ich habe aber keine kritischen Briefe gelesen, keinen einzigen.“
Nachdem ihm die bewusste Abkehr von diesem einstigen Markenzeichen des Hauses nicht zum Verhängnis wurde, ist sein Job ein wenig leichter geworden. Und seitdem dem Regisseur nicht mehr allein der Ruf vorauseilt, sich in Berlin vorwiegend für Operetten zu interessieren. „Es war vor zwei Jahren sehr einfach für das Feuilleton zu sagen, Kosky möchte die Komische Oper zum Spaßpalast machen.“ Barrie Kosky gestikuliert mit seinen kleinen, kompakten Händen – Ringe finden sich übrigens keine daran. „Aber wir machen hier ja nicht Operette als Sommertheater. Man muss mit den Stücken etwas zu sagen haben.“
Offenbachs Schöne Helena ist Kosky für seinen neuen Spielplan quasi entgegengefallen. „Es gibt viele Gründe, das Stück neu zu inszenieren – abgesehen von der Tatsache, dass es 150 Jahre alt wird. Mit der Schönen Helena wurden die starken Frauen für die Operettenbühne erfunden. Daneben muss man das Stück hier einfach mal aufführen, denn Offenbach hat am Deutschen Theater seine Stücke selbst dirigiert. Und viertens ist es ein hervorragendes Ensemblestück.“
Ein Ensemble, ein Orchester – für jede Art von Repertoire
Das feststehende, für verschiedenstes Repertoire ausgelegte, spielstarke Ensemble: Es ist ein Grund, weshalb die Komische Oper existiert – und war einer für Kosky, sich nicht nur als Regisseur, sondern auch als Intendant nach Berlin verpflichten zu lassen. „Es sind Menschen, die spielen, tanzen, sprechen können. Sie sind multitalentiert, genau wie das Orchester und der Chor.“
Dass ein einziges Ensemble ganz verschiedenartige Aufführungen stemmen muss, findet Barrie Kosky psychologisch für sein Opernhaus unverzichtbar. „Es müssen die gleichen Menschen sein, die die verschiedenen Stücke singen und spielen – und das kann kaum ein Haus auf der Welt. Dabei ist es künstlerisch sehr wichtig, damit man sieht: Das ist ein Ensemble, das ist ein Haus.“
Und so steht etwa noch Paul Abrahams Operette Ball im Savoy auf dem Spielplan, wenn im April 2015 bereits die Premiere von Schönbergs Oper Moses und Aaron angesetzt ist, ebenfalls inszeniert vom Chef. Moses ist der Mann, der nach dem Wesentlichen, dem Kern seines Glaubens sucht. Seine Botschaft an das Volk ist unpopulär, kompliziert, schwierig zu vermitteln. Sein Bruder Aaron macht den neuen Gott für die Menge greifbar, initiiert ein farbenfrohes, feuchtfröhliches Wunder nach dem anderen. „Für mich ist es absolut selbstverständlich, gleichzeitig konzeptuell und populär zu denken. Nur in Deutschland scheint das irgendwie immer ein Problem zu sein.“ Wie derzeit kein anderer in Berlin ist Barrie Kosky seinem Publikum Moses und Aaron zugleich: der einsame Verkünder der schwierigen Botschaft – und der Moderator, der zum gleichen Zweck den Champagner schwenkt.