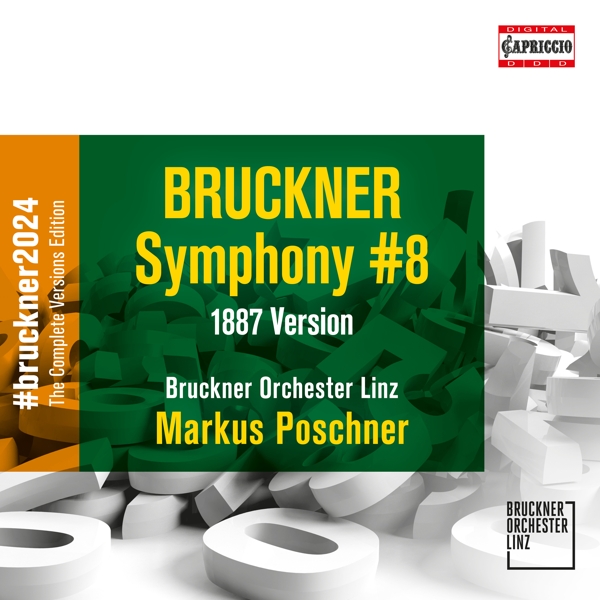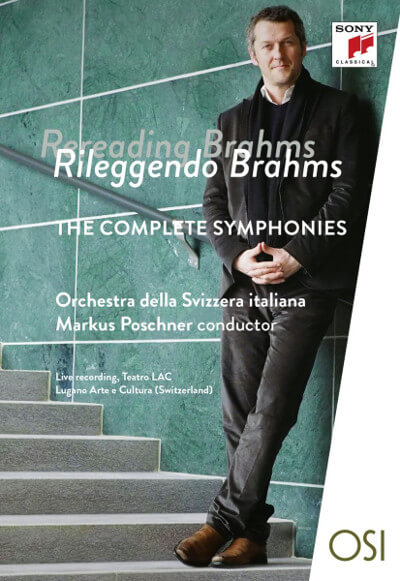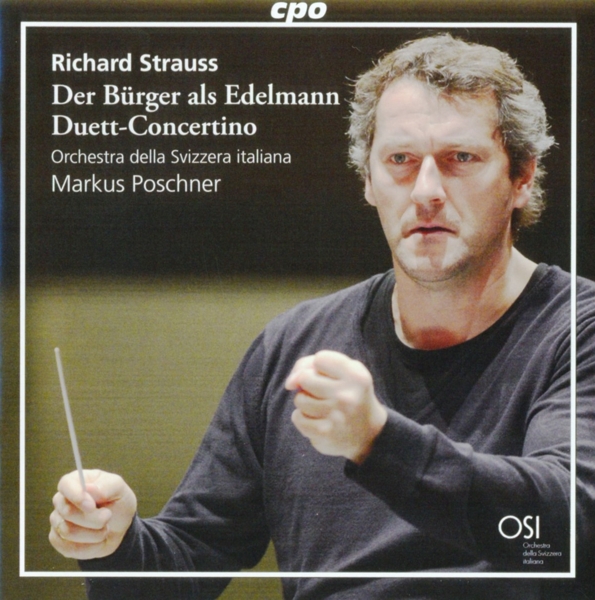Das Beil hat sie unter dem Sofa versteckt. Einst wurde ihr Vater damit brutal im Bade erschlagen. Jetzt dürstet Tochter Elektra nach Rache. Und verpasst dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter dann tatsächlich selbst den finalen Todesstoß. Diese Elektra überwindet ihren Hamlet-Komplex von (männlichem) Handeln oder (weiblichem) Nicht-Handeln – und schlägt zu. Sonst gern als echt griechische Mauerschau dem Auge des Betrachters vornehm entzogen zeigt Michael Schulz das große Schlachten am Ende dieses immer wieder und immer noch blutrünstig prallen Thrillers als gemeinen Straßenmord. Erst erledigt Orest seine Mutter im Off, die dann hübsch drappiert vom Dach eines Automobil aus der Entstehungszeit der Oper herabhängt, dann sticht er auch Aegisth ab, dem Elektra schließlich den Rest gibt.

Elektra spielt noch mit Teddys – und wird zur Terroristin
Alles tot, tot denn alles, heißt es in Linz geradezu tristanesk. (Die legendäre Deutung von „Tristan und Isolde“ durch Heiner Müller ist hier übrigens in einer Rekonstruktion der Bayreuther Inszenierung zu bestaunen!) Denn auch der Chor, der in Anknüpfung an die griechische Tragödie in dieser Inszenierung eine heimliche Hauptrolle spielen darf, wird vor Elektras erlösendem letzten „Schweigen und Tanzen“ noch um die Ecke gebracht. Orest und die Seinen mutieren zum veritablen Killerkommando. Die Lust am Auge um Auge, an der immer weiter geschraubten Spirale der Rache scheint eben in der Familie zu liegen. Auch Elektra selbst leidet in Linz nicht nur freudianisch an ihrem Vaterkomplex, kann sich vom Dasein des offenbar missbrauchten kleinen Mädchens nie richtig trennen, spielt in ihrem Kinderzimmer mit dem Kreisel und liebkost ihre Teddys. Über die Frühpubertät kommt sie nicht hinaus.
Doch diese Elektra gleicht bereits an der von den Mägden gedeckten wohl situierten Tafel des Beginns einer Aufbegehrenden, einem Mädchen aus bürgerlichem Hause, das ausbrechen will, das zur Terroristin taugt, das morden will. „Hilf uns ins Freie“ singt nicht nur Chrysothemis, sie hat die Hoffnung der ungleichen Schwestern auch an die Wand ihres Zimmers gemalt, deren Stofftapete sie später schwarz übertüncht. Waren nicht auch die RAF-Terroristen einst Sprößlinge aus anständigem gutem Haus? Studienratssöhne? Pastorentöchter?

So packend und so blutrünstig dieser Krimi auch erzählt ist, das Schicksal der Elektra berührt kaum
Michael Schulz repolitisiert die „Elektra“ des Genie-Duos Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss im Sinne eines bürgerlichen Trauerspiels, das Elemente des frühen 20. Jahrhunderts (mithin der Entstehungszeit der Oper) mit der Gothic-Szene des späten amalgamiert, und geht damit gleichwohl zu den antiken Wurzeln des Stoffs zurück. Der Regisseur konkretisiert die psychoanalytisch tiefschürfende Anverwandlung der Autoren, was in seinem mitunter gar filmischen Realismus der Plausibiltiät der Figuren einerseits zuträglich ist, ihnen andererseits aber auch ihre unerhörte psychische Polyphonie nimmt.

So packend und so blutrünstig dieser Krimi auch erzählt ist, das Schicksal der Elektra berührt kaum. Die gesellschaftliche Lesart behauptet die seelischen Abgründe der Figuren nur, sie lässt uns zu selten wirklich in sie hineinblicken. Vieles ist freilich klug beobachtet: Elektra scheint sich derart verrannt in ihr Lebensziel der Rache zu haben, dass sie jeglicher Empathie für ihre Mitwelt verlustig gegangen ist. Sie hört nicht zu, wenn ihre Schwester vom „Weiberschicksal“ des Kinderkriegens schwärmt. Sie kann sich in ihrer Verkapselung dem eins verbannten, jetzt wiedererkannten Bruder kaum zuwenden, spielt stattdessen wieder mit den Teddys ihrer Kindheit, zieht sich in sich selbst zurück. Am Ende, wenn ihre Mission erfüllt ist, wirkt sie leer. Die Vergangenheit ist ausgelöscht, die Mission Rache ist erfüllt, das Kinderzimmer ist nun einem schwarzen Loch gewichen. Es bleibt dieser Elektra keinerlei weitere Perspektive, kein Hoffnungsschimmer, nichts.
Utopiepotenzial, Zwischentöne und Magie entströmen allein dem Orchestergraben
Wo der Regisseur sich primär auf den Text berufen kann und ihn in deutliche Bilder gesetzt hat, weiß die Musik mitunter dennoch mehr. In ihr stecken Utopiepotenzial, Zwischentöne und Magie. Als wolle er Friedrich Nietzsche auf Richard Strauss anwenden, hat Chefdirigent Markus Poschner hier nun gleichsam die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik hervorgebracht. Was man nicht sieht, das hört man an diesem Abend auf so bewegende Weise wie irgend möglich. Was auf der Bühne vielsagend verkleinert wird, das macht das Bruckner Orchester Linz im Graben zum großen Ereignis. Da schillert es, da walzert es, da sehnt es sich so grandios, dass die ganze gigantische Vielschichtigkeit der Partitur zum Ausdruck kommt.
Elektras innige, immer weiter ins Piano zurückgenommene Anrufung des Bruders „Orest, Orest, Orest“ musiziert Poschner als wahren Rubato-Rausch aus, mit einem gewagt verlangsamten Tempo, dem sein Orchester eine Innenspannung zum Bersten verleiht. Die Subtilitäten wie die Brutalitäten der Musik kostet Poschner überlegen aus, spürt die luziden „Rosenkavalier“-Momente ebenso auf wie die artikulatorisch geschärften harmonischen Entgrenzungen. Die prägnant wortdeutlich gearbeitete Mägdeszene ist gleich zu Anfang das Zeugnis exzellenter Ensemblearbeit. Man kann die „Elektra“ anders dirigieren, besser wohl kaum.
Ensemblekultur vom Feinsten

Die Besetzung der Hauptrollen verblüfft. Die Linzer kommen für das Monsterwerk mit nur einem Gast aus: Miina-Liisa Värelä als Elektra ist in Gestalt und Stimme eine echte nordische Maid, ihr dunkel gefärbter Sopran hat mädchenhafte jubelnde, vollkommen unangestrengte Höhen und eine natürlich ausgebaute Mittellage. Um sie herum glänzt ein junges Strauss-Ensemble von Format. Katherine Lerner singt die Klytämnestra nicht als deklamierende Alte, die schon lange nicht mehr schlafen kann, sondern mit dem klaren Mezzo einer Frau, die noch ihren Teil vom Leben abbekommen will. Brigitte Geller stattet die Chrysothemis mit sopranheller Innigkeit. Matthäus Schmidlechner demonstriert als Ägisth, dass auf ihn noch ganz andere tenorale Aufgaben warten. Viel Jubel für die musikalische Seite, einige erregte Buhs fürs Regieteam.
Landestheater Linz
R. Strauss: Elektra
Markus Poschner (Leitung), Michael Schulz (Regie), Dirk Becker (Bühne), Renée Listerdal (Kostüme), Katherine Lerner, Miina-Liisa Värelä, Brigitte Geller, Matthäus Schmidlechner, Michael Wagner, Philipp Kranjc, Etelka Sellei, Kateryna Lyashenko, Mathias Frey, Timothy Connor, Gotho Griesmeier, Isabell Czarnecki, Jessica Eccleston, Florence Losseau, Svenja Isabella Kallweit, Theresa Grabner, Bruckner Orchester Linz, Chor des Landestheater Linz
Dirigent Markus Poschner vor der Generalprobe zu „Elektra“: