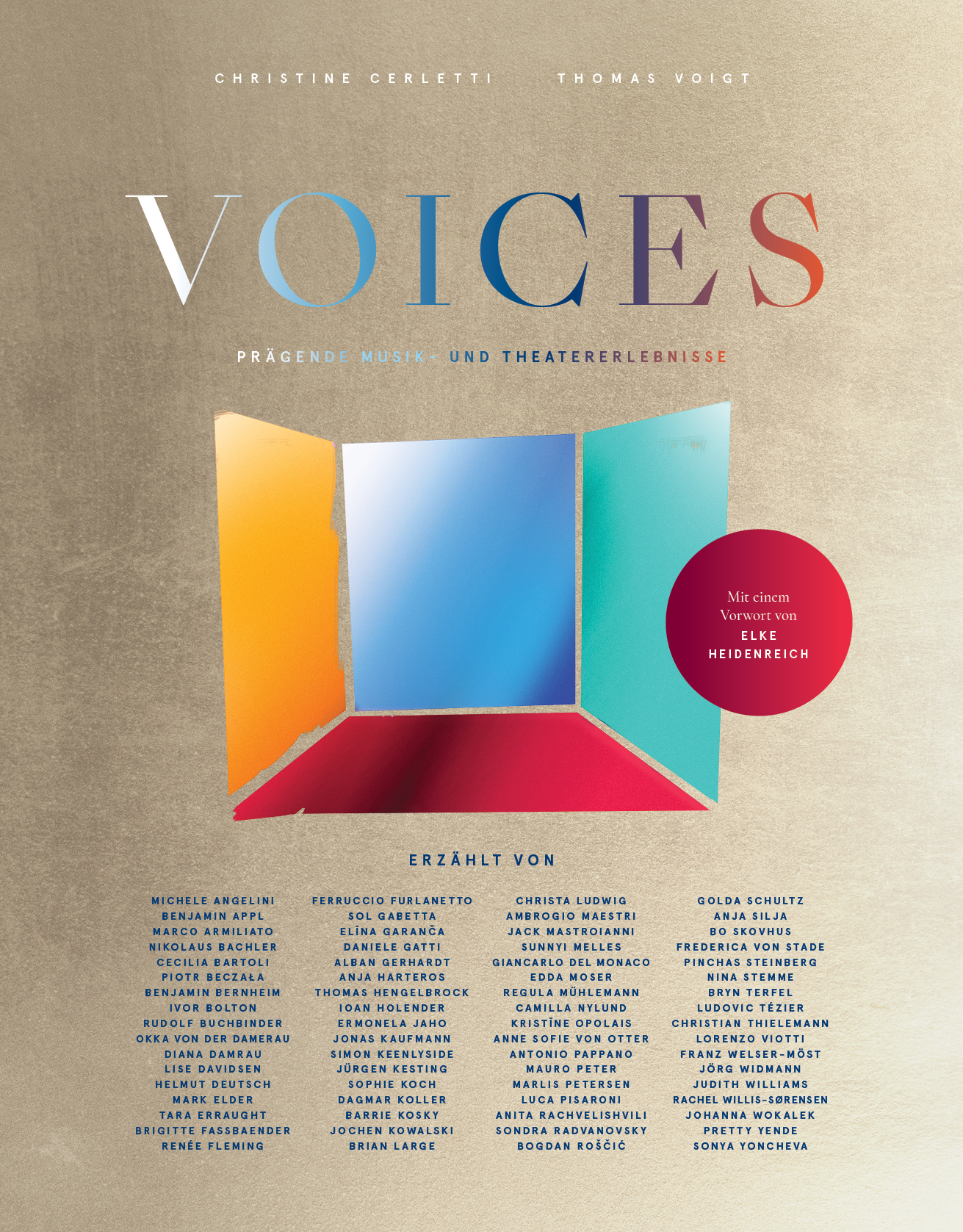Die Schlächter der Weltgeschichte planen perfide. Wenn es ihnen hilft, können sie ausgesprochen gute Manieren an den Tag legen, sich in ihre Opfer einfühlen und deren Verhalten damit perfekt manipulieren. Sie tragen mitunter so feinen Zwirn wie ein Edelmann, die Bügelfalte ihrer Anzüge ist so straff gezogen, dass man meinen müsste, sie würden sich an die Regeln des aufgeklärten menschlichen Miteinanders halten. Doch dann schlagen sie zu, sadistisch zeigen sie ihr wahres Gesicht, sie morden in Massen, vergewaltigen und erniedrigen. Ihnen gilt die Devise: Je brutaler und menschenverachtender, desto besser. Denn dann spielt ihnen die Angst der potentiellen Opfer in die Hände, die kaum mehr wagen, sich zu wehren.
Der intelligente Sadismus des reinen Bösen

Im zweiten Akt von Puccinis „Tosca“ nennt der freiheitsgesinnte Maler Cavaradossi seinen Peiniger Scarpia, der ihn im Keller seines Heims von seinen Knechten foltern lässt, einen „Carnefice“. Der amerikanische Präsident bezeichnete den russischen Despoten jüngst so ähnlich – nämlich einen „Butcher“. Roms Polizeichef im Jahr 1800, dem Puccini dann hundert Jahre später pralles Bühnenleben einhauchte, ist ein ebensolcher Schlachtmeister. Wie Meisterregisseur Barrie Kosky das mordende Monster jetzt in der Gestalt des armenischen Prachtbaritons Gevorg Hakobyan auf die Bühne der Dutch National Opera bringt, lässt das Publikum erschaudern. Denn der intelligente Sadismus des reinen Bösen hat eben weniger mit Verrücktheit als mit ausgefeilter Taktik zu tun. Nur eines fehlt solchen Tätern: der Sinn fürs Strategische. Scarpia bezahlt seine Untaten mit dem eigenen Leben. Just eine Frau bringt ihn zur Strecke – die von ihm begehrte Sängerin Tosca sticht ihn kurzerhand ab.
Gut gekühlter Weißwein im weiß schicken Designer-Loft
Bei Kosky passiert das in der Küche des schicken weißen Designerlofts von Scarpia. Da hängen passenderweise ausreichend scharfe Messer an der Wand. Schließlich bereitet sich der Schlächter gern höchstselbst frischen Lachs zu, den er roh, aber in fein geschnittenen Scheiben verzehrt. Dazu gibt es gut gekühlten Weißwein, von dem er – gute Manieren hat das Schwein eben doch (siehe oben) – auch der Dame kredenzt, mit der er gerade einen Deal einfädelt: Er lässt den Staatsgefangenen Cavaradossi, den Liebsten der Diva, laufen, dafür soll sie sich dem Scheusal sexuell hingeben. Doch statt in dieser Hinsicht zum Ziel zu kommen, steht Tosca ihre Frau – und befördert Scarpia in die Hölle, wo allein er hingehört. „Vor ihm zitterte ganz Rom“, gibt sie singsprechend zu Protokoll und legt dem Erledigten ihre Kette auf die Brust, an der das christliche Kreuz hängt. Selbst dem Mörder gilt das Vergebungsversprechen des Gekreuzigten, das sich Tosca zu eigen macht.
Erster Akt: von Konventionen und Klischees befreites Black Box-Ambiente
Wie Barrie Kosky diesen größten Thriller des Musiktheaters beim Wort nimmt und in die Gegenwart verfrachtet, das klappt grandios. Es geht so sehr unter die Haut, es schockiert und berührt, weil das Regiegenie zunächst einmal Ballast abwirft, so ziemlich allen Ballast der Aufführungsgeschichte. Einen Kirchenraum muss ihm Rufus Didwiszus (Bühne) und dem die Maria Magdalena malenden Cavaradossi im ersten Akt mitnichten bauen. Die gigantisch breite Bühne der Niederländischen Nationaloper in Amsterdam bleibt zunächst zur Gänze leer. Aus dem Bühnenboden bricht der Flüchtling Angelotti zu den brutalen Akkorden des Anfangs hervor. Der Mesner fegt die Holzteile hernach – genervt einige italienische Flüche vor sich hinbrabbelnd – gen Unterbühne weg. Die Interaktion der drei Protagonisten – Tosca, Cavaradossi, Scarpia – entfaltet sich in diesem kargen, von Konventionen und Klischees befreiten Black Box-Ambiente so plastisch wie nie zuvor. Keine Madonna, kein Kruzifix. Nur die Staffelei des Malers, Pinsel und Farbe – und ein Blumenbouquet zieren diese Leere. Sie gibt Raum für ein psychologisches Kammerspiel von maximaler Dichte, das Koskys kleine kluge Nuancen groß werden lässt. Und sogar Platz für Poesie bereitet, wenn Scarpia aus dem floralen Schmuck just eine blaue Blume (der Romantik?) herauszieht, sie an die Nase legt, den Duft zu genießen scheint – und ein heimliches Zeichen an Tosca sendet: Denn die Diva trägt beim Kirchgang just Unschuldsblau.
Es spritzt das Splatter Movie-Blut

Zum „Te Deum“-Finale des ersten Akts dann weitet Rufus Didwiszus die Black Box doch noch – zum lebenden Altarbild. In der Chorszene – jene zwischen weißer und schwarzer Messe changierende teuflisch-göttliche Beschwörung – steckt das singende Kollektiv durch ein gigantisches Triptychon-Gemälde, das nun in der Rückwand auftaucht, seine Köpfe. Das klingt nicht nur krass intensiv, es lässt die leidenden Kreaturen, die hier wie aus der Hölle heraus tönen, als Projektionen aus Scarpias Kopf erscheinen: Sind es die früheren Opfer des Schlächters oder die Gefolterten anderer Mörder der Menscheitsgeschichte? „Tosca, Du machst mich Gott vergessen“, outet sich Scarpia mit gierigem Blick ins Publikum, einen Lichtspott im Gesicht. Tritt der Schlächter hier noch genau wie seine Schergen in wohlgeschneiderten grauen Anzug auf, hat er den Zwirn im zweiten Akt zusammen mit seinen Hemmungen zum physischen Übergriff abgelegt. Scarpia lässt Cavarodossi nun gar die Finger der rechten Hand abtrennen, an denen nicht zuletzt ein Ring prangte, den er sich, nachdem er das Blut abgewaschen hat, selbst ansteckt. So viel Splatter-Movie auf der Opernbühne darf schon sein. „Tosca“ nimmt dessen Drastik vorweg. Und Kosky greift mit dem Ring ein Requisit des dritten Akts vorab auf (dort wird Cavaradossi dann ja just einen Ring als letztes Zeichen seines Reichtums für die Gnade eines Abschiedsbriefs an Tosca einsetzen). Doch auch ungeahnte Nuancen entdeckt Kosky: Ihr „Vissi d’arte“ singt die kluge, selbstbewusste, hier so gar nicht primadonnennaive Tosca nicht für sich, sie adressiert Scarpia damit direkt, blickt ihn mitleidsheischend an. Lässt sich der Schlächter erweichen? Mitnichten. Das gilt für ihn so sehr wie für den Massenmörder im Kreml.
Orchestrale Weltklassemomente: Wie Lorenzo Viotti seinen Puccini zur Chefsache macht
Wenn in Amsterdam aber ein vollends perfekter Musiktheaterabend als Opernkrimi entsteht, dann liegt das neben dem Regisseur auch am Dirigenten. Hier macht Lorenzo Viotti seinen Puccini zur Chefsache und zeigt im hier praktizierten Stagionetheater (das keinen Repertoireschlendrian kennt), wie weit man es doch mit dieser grandiosen Partitur treiben kann. Genüsslich musiziert er jede Faser des Stücks aus, hat mit den Sängern penibel den Sinn eines jedes Rubato und jeder Textnuance gearbeitet und wagt oftmals verblüffend langsame Tempi, die den Spannungssog dieses Krimi noch zusätzlich stärken, weil auf einmal die harmonischen Kühnheiten, die subkutanen Kommentare von Einzelinstrumenten und die enorme Modernität Puccinis zum Ausdruck kommen. Sollte je ein Opernfreund Puccini für ein Kitschkomponisten gehalten haben: In Amsterdam wird er eines Besseren belehrt. Das Netherlands Philharmonic Orchestra kostet jeden Moment als Kostbarkeit aus: Das in intimem Pianissimo geblasene, ganz zarte Klarinettensolo in Cavaradossis „E lucevan le stelle“ ist ein Beispiel für all die Weltklassemomente, von denen es in fast jedem Takt einen gibt.
Puccinigesang ohne Klischees

Auch sängerisch betreten die Niederländer Neuland, indem sie auf der Bühne unverbrauchte Puccini-Entdecker präsentieren. Nur der baritonmarkante Gevorg Hakobyan ist ein erfahrener Vertreter des Bilderbuchbösewichts. Joshua Guerrero ist ein Cavaradossi-Debütant mit berückend schönem, leichtgängigem und dennoch anschmiegsamem Tenor, der nicht mit hohen Tönen protzt, sondern auf verletzliche und zutiefst verletzte Männlichkeit setzt. So pianissimozart innerlich hat ein Tenor lange nicht seine zweite, von der Welt Abschied nehmende Arie gesungen. Die gertenschlank attraktive blonde Schwedin Malin Byström geht ihre Tosca von Mozart und Verdi kommend an, also nicht mit der veristischen Verve einer übersteigerten Dramatik, sondern mit Zwischentönen, vielen anrührenden Farben und edler Phrasierungskunst. Ein großer, ein seltener, ja, ein geradezu perfekter Opernabend.
Dutch National Opera
Puccini: Tosca
Lorenzo Viotti (Leitung), Barrie Kosky (Regie), Rufus Didwiszus (Bühne), Klaus Bruns (Kostüme), Franck Evin (Licht), Malin Byström, Joshua Guerrero, Gevorg Hakobyan, Martijn Sanders, Federico De Michelis, Lucas van Lierop, Maksym Nazarenko, Alexander de Jong, Netherlands Philharmonic Orchestra