Sechs Jahre leitete Anu Tali als Musikdirektorin das Sinfonieorchester in der 50.000-Einwohner-Stadt Sarasota an der Westküste Floridas, hierzulande folgt sie immer wieder den Einladungen renommierter Klangkörper. Kraft für ihre vielen Gastspiele findet die gebürtige Estin im heimischen Tallinn, von wo sie sich in einer kurzen Ruhephase zum Interview schaltet.
Ihre musikalische Laufbahn hat mit einem Klavierstudium begonnen. Was faszinierte Sie in jungen Jahren am Klavier?
Anu Tali: Meine Zwillingsschwester Kadri und ich zeigten früh musikalisches Talent. Mit sechs meldete uns meine Mutter zum Klavierunterricht an, um zu sehen, ob es sich lohnen würde. Wie wohl jedes neugierige Kind liebte ich das Improvisieren, also habe ich weitergemacht. Mit 15 wurde ich an der Musikoberschule aufgenommen, wo ich endlich auf Gleichgesinnte traf.
Was hat den Ausschlag gegeben, Dirigentin zu werden?
Tali: Mich hat Musik immer im größeren Zusammenhang interessiert. Als ich mit dem Chordirigieren begann, sagte man mir, ich könne musikalisches Denken vermitteln und Klänge formen. Ein Jahr vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde ich als Gasthörerin nach Stockholm eingeladen. Ich war überglücklich, zum legendären Eric Ericson reisen zu dürfen. Ich bezweifle, dass ich offiziell an der Musikakademie aufgenommen worden wäre, doch die Professoren in der freien Welt verstanden, wie wichtig diese Gelegenheit für mich als Jugendliche war. Zurück in Estland, begann ich ein Dirigierstudium. Partituren zu lernen, die vertikalen Strukturen zu hören, den Klang des Orchesters zu spüren, ja, die ganze menschliche Kommunikation, all das wurde meine Welt.
Sie haben unter anderem beim finnischen Dirigentenmacher Jorma Panula studiert.
Tali: In den Neunzigern konnte ich mir keine Reise nach Berlin oder Finnland leisten. Umso glücklicher war ich, als Jorma eines Tages in Estland eine Meisterklasse gegeben hat. Aus irgendeinem Grund fiel ich ihm auf, und er sagte, er wolle mir in Helsinki noch mehr zeigen. Ohne eine Gegenleistung zu verlangen, lud er mich zu Proben und Konzerten ein. Manche bezeichnen ihn heute als chauvinistisch, da er sehr offen und nicht gerade wohlwollend über Dirigentinnen sprach, aber das war damals nicht wirklich ein Thema. Jorma war immer schonungslos ehrlich. Wer Dirigent werden wolle, müsse das Gefühl haben, ohne den Beruf nicht leben zu können. Man müsse bereit sein, die Schattenseiten zu akzeptieren, alle Mühen auf sich zu nehmen und dürfe nie die Hoffnung verlieren. Später habe ich einen Kurs bei ihm in Moskau besucht. Ich dachte, ich hätte so gut dirigiert. Doch anstatt mich zu loben, fragte Jorma nur: „Wer kommt zuerst: du oder Tschaikowsky?“ Er wollte, dass man sich bewusst macht, wie und warum man probt, was es bedeutet, Dirigent und zugleich ein Mensch zu sein, der mit einem Orchester kommuniziert. Es war ernüchternd – und eine sehr gute Lektion.
Sie setzen gerne Musik ihrer Landsleute Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür und Tõnu Kõrvit aufs Programm. Wieso?
Tali: Es geht mir nicht nur um Esten. Viele Komponisten leiden darunter, dass ihre Werke zu Lebzeiten nicht gespielt werden. Doch ich lebe, sie leben und wir können miteinander über die Musik sprechen. Musik entsteht hier und jetzt, und wir alle sind Teil dieses historischen Prozesses. Bei einem Nachwuchswettbewerb sagte kürzlich ein älterer Kollege zu den Teilnehmern: „Musik ist kein Museum. Es gibt noch so viel Neues zu entdecken. Mozart und Beethoven sind großartig, ja, aber ihre Bedeutung ist längst bewiesen.“ Dem kann ich nur zustimmen.
Ist es leichter, sich ein Werk anzueignen, wenn man auch die Muttersprache des jeweiligen Komponisten beherrscht?
Tali: Absolut. Wenn man die Partituren von Brahms oder Beethoven betrachtet, erkennt man ihre vertikale Struktur. Russische Komponisten hingegen phrasieren oft sehr fließend. Die Syntax und die gesprochene Sprache spiegeln sich unmittelbar in der Musik wider. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass in der Kommunikation miteinander das Eis erst wirklich bricht, wenn alle ihre eigene Sprache verwenden können. Dann kommt die innere Stimme eines Menschen zum Vorschein. Das erklärt, warum mein Instrument der Mensch selbst ist.
Sie haben über die Orchesterarbeit einmal gesagt: „Ich werde niemals etwas vorschreiben, was nicht aus den Menschen selbst herauskommt.“ Was meinen Sie damit?
Tali: Jedes Orchester spielt bestimmte Musik auf seine individuelle Art und Weise. Manchmal stifte ich zwar etwas Chaos, damit die Musiker in einem größeren Klang baden können, doch ich halte nichts davon, Traditionen zu zerstören. Reizvoller ist es, darauf aufzubauen. Orchester sind heutzutage sehr aufgeschlossen, das ist ein Geschenk. Aber man sollte nie vergessen, dass es nicht den einen „richtigen“ Mozart oder Beethoven gibt. Am Ende des Tages geht es darum, eine Geschichte zu erzählen.

Eine besondere Geschichte hat auch das Nordic Symphony Orchestra (NSO), das Sie 1997 mit Ihrer Schwester Kadri ins Leben gerufen haben.
Tali: Wir hatten nie vor, ein Orchester zu gründen. Es war als ein einmaliges Projekt gedacht, um den Kulturaustausch zwischen Estland und Finnland zu fördern. Aber die Musiker wollten weitermachen, also haben wir unsere erste Saison mit überwiegend populären Programmen bestritten. Mittlerweile geben wir Werke in Auftrag. Das NSO funktioniert im Prinzip wie eine Rockband: Die erste Probe ist meist ohrenbetäubend und chaotisch, jeder will etwas ausprobieren, und ich lasse allen freien Lauf für ihre Kreativität. So entdecken wir einzigartige Klanglandschaften – das ist es, was mich antreibt. Es ist fast absurd, wenn das Publikum mir nach einem Konzert mehr zujubelt als den Musikern im Orchester, die gerade etwas Außergewöhnliches gespielt haben.
Estlands Liederfest „Laulupidu“ ist als Kulturerbe von der UNESCO anerkannt. Gehört das Singen auch zu Ihrer Identität?
Tali: Jeder Este ist im Innersten ein Chorsänger! Singen begleitet uns auf allen Wegen, sogar in Clubs werden Volkslieder gesungen. Die Energie des gemeinsamen Singens während „Laulupidu“ ist unbeschreiblich: die Einheit der Stimmen, die geteilte Freude, das Gefühl, eins zu sein … Für unsere kleine Nation ist das lebenswichtig. Manchmal fühle ich mich fast schuldig, dass ich das Fest bereits zweimal dirigieren durfte. Chorleiter sind in Estland chronisch unterfinanziert, sie verdienten stärkere Aufmerksamkeit.
Worin unterscheidet sich die Klassik-Kultur in den USA von der in Europa?
Tali: Als Estin ist es mir anfangs schwergefallen, die schiere Größe des Landes zu begreifen. Jeder Ort folgt seiner eigenen Dynamik, und die Orchester sind privat finanziert. Das Publikum in Sarasota fühlte sich konservativen Traditionen verpflichtet, sodass ich die Programme anfangs eher um Komponisten wie Brahms konzipiert habe. Wenn das Leben angenehm und das Essen gut ist, will man sich eben nicht den Schrecken in Schostakowitschs Musik stellen. Dafür muss man bereit sein, die Komfortzone zu verlassen – das war nicht immer einfach, doch es ist gelungen. Einmal habe ich mit dem Rückhalt des Orchesters, das genauso aufgeregt war wie ich, sogar Heiner Goebbels’ „Songs of Wars I Have Seen“ aufs Programm gesetzt. Ein voller Erfolg! Da habe ich gelernt, dass die Menschen das Orchester nicht als Institution per se unterstützen, sondern die Menschen dahinter. Man muss also einen Weg finden, die Menschen von der Musik zu begeistern. Wir können Stücke aufführen, aber wahre Bedeutung erhalten sie erst durch diejenigen, die sich mit ihnen identifizieren.
Aktuelles Album:
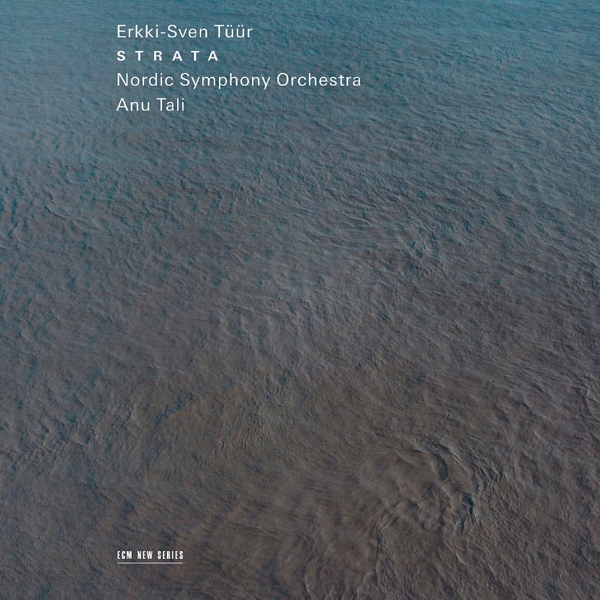
Tüür: Sinfonie Nr. 6 & Noesis
Jörg Widmann (Klarinette), Carolin Widmann (Violine), Nordic Symphony Orchestra, Anu Tali (Leitung.) ECM







