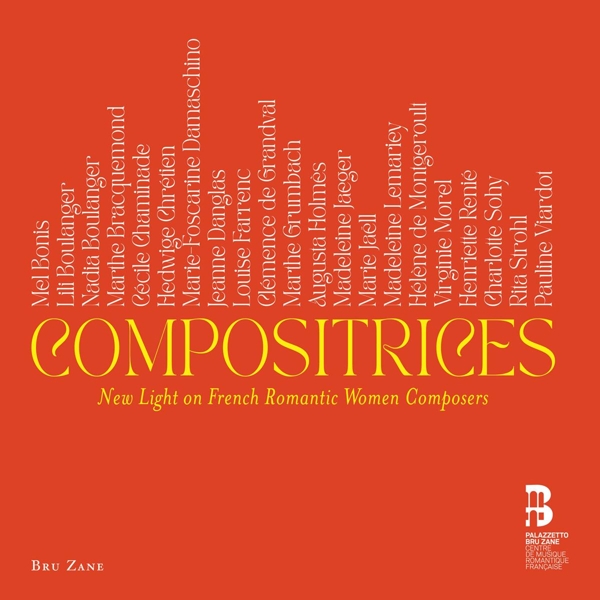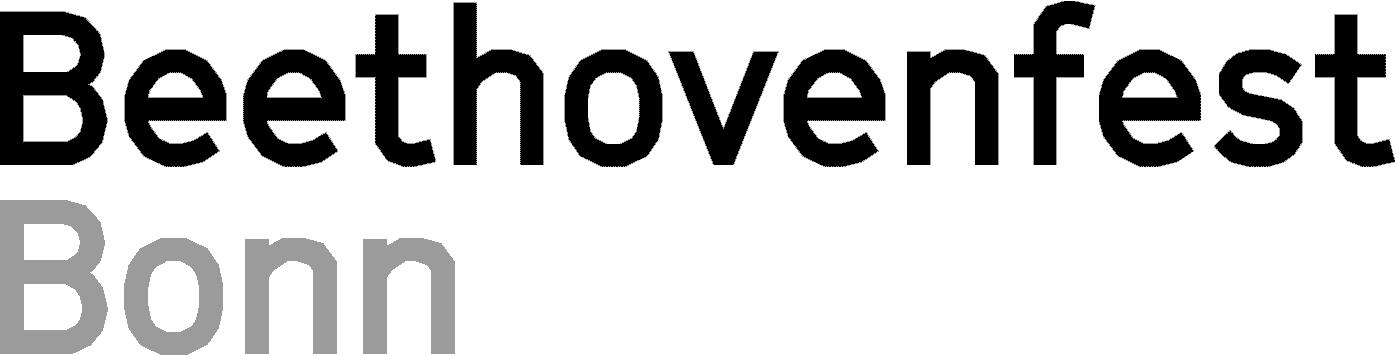Sie haben bereits 1995 eine erste Fassung von „Metropolis“ komponiert und diese mehrmals überarbeitet. Wie ist es nun zur Neukomposition „Metropolis rebooted“ gekommen?
Martin Matalon: Das Werk ist omnipräsent in meinem Leben. Ich habe schon seit Jahren mit François-Xavier Roth, der die Kammermusikversion einige Male dirigiert hat, über eine Orchesterfassung nachgedacht. Über die Möglichkeit, die gesamte Klangpalette eines Orchesters nutzen zu können und daraus die Kraft zu entwickeln, um diesen unvergesslichen, extremen, großartigen Bildern gerecht zu werden. Dann erteilten mir das Gürzenich-Orchester und das Orchestre de Paris den Kompositionsauftrag dafür. Ich habe fast eineinhalb Jahre daran gearbeitet, es war mein einziges Projekt in der Corona-Zeit.
Vor welchen Herausforderungen standen Sie?
Matalon: Mir standen ungefähr 85 Instrumente im Orchester zur Verfügung, darunter viele Stimmgruppen wie die Streicher oder die Waldhörner, die in der Originalversion nicht vorhanden waren. Dazu eine umfangreiche Elektronik. Die Kunst bestand darin, neue Klangregister zu finden und diese innerhalb des Orchesters ausgewogen zu verteilen. Ich wollte ja nicht einfach nur alles lauter und dichter machen, sondern eine große Bandbreite an Farben und Texturen einzusetzen. Der richtige Klang hat für mich die Bedeutung, wie sie die Harmonie für die Musik im 19. Jahrhundert hatte. Außerdem war mir wichtig, dass meine Komposition nicht blind dem Rhythmus der Bilder auf der Leinwand folgt. Es braucht Kontrapunkte zwischen Musik und Bild, damit Atmosphäre entsteht. Auch Stille ist ein wichtiger Bestandteil in dieser Filmmusik. Ich unterscheide zwischen vier verschiedenen Arten von Stille, etwa die semantische Stille, in der man den Ton spürt, aber keine Musik hört. Das erzeugt Intimität.
Worin unterscheidet sich „Metropolis rebooted“ von seinen Vorgängern?
Matalon: In der Originalversion war alles viel straffer. Jetzt sind die Klangfarben breiter gefächert und ich werfe Schlaglichter auf jede einzelne Stimme im Orchester. Ich habe auch nicht jede Pause übernommen. Beispielsweise kommen nach zwei Stunden mit der Zerstörung von Metropolis die „lautesten“, gewaltsamsten Bilder des Films. In der alten Version entschied ich mich hier für eine dreiminütige Pause. Totale Stille! Jetzt gibt es hier einen intimen Streichersatz. Auch wenn ich zwischen den einzelnen Versionen grundlegend die Struktur beibehalten habe: Die Musiken gleichen sich nicht mehr eins zu eins.

Ihre Musik enthält viel Elektronik, die mit Regisseur Thomas Goepfer am IRCAM, dem Forschungsinstitut für Musik und Akustik im Pariser Centre Pompidou, entstanden ist.
Matalon: Am IRCAM arbeiten Komponisten mit computer-musikalischen Regisseuren (Réalisateurs en Informatique Musicale, RIM, Anmerkung d. Red.) zusammen. Diese beherrschen die extrem ausgefeilte Software, die ich zwar bis ins Detail verstehe, aber praktisch nicht anwenden kann. Thomas Goepfer kenne ich von früheren gemeinsamen Projekten. Als RIM vermittelt er zwischen den Wissenschaftlern und mir als Komponisten. Das ist im Ökosystem der elektronischen Musik eine ganz wichtige Verbindung. Außerdem ist Thomas selbst Musiker. Er hat häufig eigene Vorschläge gemacht, die den neuesten Stand der Forschung widerspiegelten und auf die ich selbst als Komponist gar nicht gekommen wäre. Thomas und ich pflegen ein offenes und symbiotisches Verhältnis zueinander. Er hat die ganze technische Seite verantwortet. Insgesamt waren vier RIMs an „Metropolis rebooted“ beteiligt, ich habe ja auch Elektronik aus früheren Versionen wiederverwendet.
Was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Uraufführung?
Matalon: Für mich ist hier der Begriff „ciné-concert“ entscheidend, da er das Wort „Konzert“ in den Mittelpunkt stellt. Der Film läuft zwar auf der Leinwand, aber es gibt ein Live-Orchester. Das Publikum wird in den Sound eintauchen können, weswegen die Elektronik von allen Seiten im Raum kommen wird. Das sorgt für Lebendigkeit und schafft bei Musikern und Zuhörern dieses aufregende Gefühl, etwas zu erleben. Es handelt sich hier nicht um „Filmmusik“ im eigentlichen Sinne. Die Musik übernimmt eine primäre Rolle, sie wird quasi zum „Sprecher“ des Films.
Haben Sie eine Lieblingsstelle in der neuen Fassung?
Matalon: Es gibt zwei Szenen, die mir besonders gefallen. Gleich zu Beginn zeigt Fritz Lang die maschinelle Ausstattung der Stadt: Gigantische Zahnräder, Achsen, Hebel und Flaschenzüge vereinen sich in andauernden komplexen Bewegungen zu einer kubistischen Komposition. Zu jeder konkreten visuellen Sequenz gibt es ein spezifisches klangliches und rhythmisches Äquivalent. Die zweite Szene ist die der Flut fast am Ende des Films: Die gewaltigen, dynamischen und stark bevölkerten Bilder finden entgegen aller Erwartungen in einer musikalischen Atmosphäre statt, die statisch, langsam und intim ist. Die Beziehung zwischen Bild und Musik ist hier absolut konträr. Paradoxerweise wertet das beide Pole auf.
„Metropolis“ begleitet Sie seit fast dreißig Jahren als Komponist und als Dirigent. Welche Beziehung haben Sie zu diesem Werk entwickelt?
Matalon: Eine ganz merkwürdige, muss ich Ihnen gestehen. Ich habe zu vielen Literaturvorlagen und Stummfilmen die Musik geschrieben. Ich liebe die Werke von Luis Buñuel, dem ich mich ästhetisch und philosophisch sehr nahe fühle, genauso wie Jorge Luis Borges. Aber Fritz Lang? Sein Werk ist eine ganz andere Welt, die mir kulturell nicht ferner sein könnte. Paradoxerweise ist „Metropolis“ aber zu meiner wichtigsten und intimsten Komposition geworden. Warum das so ist, habe ich selbst noch nicht verstanden.