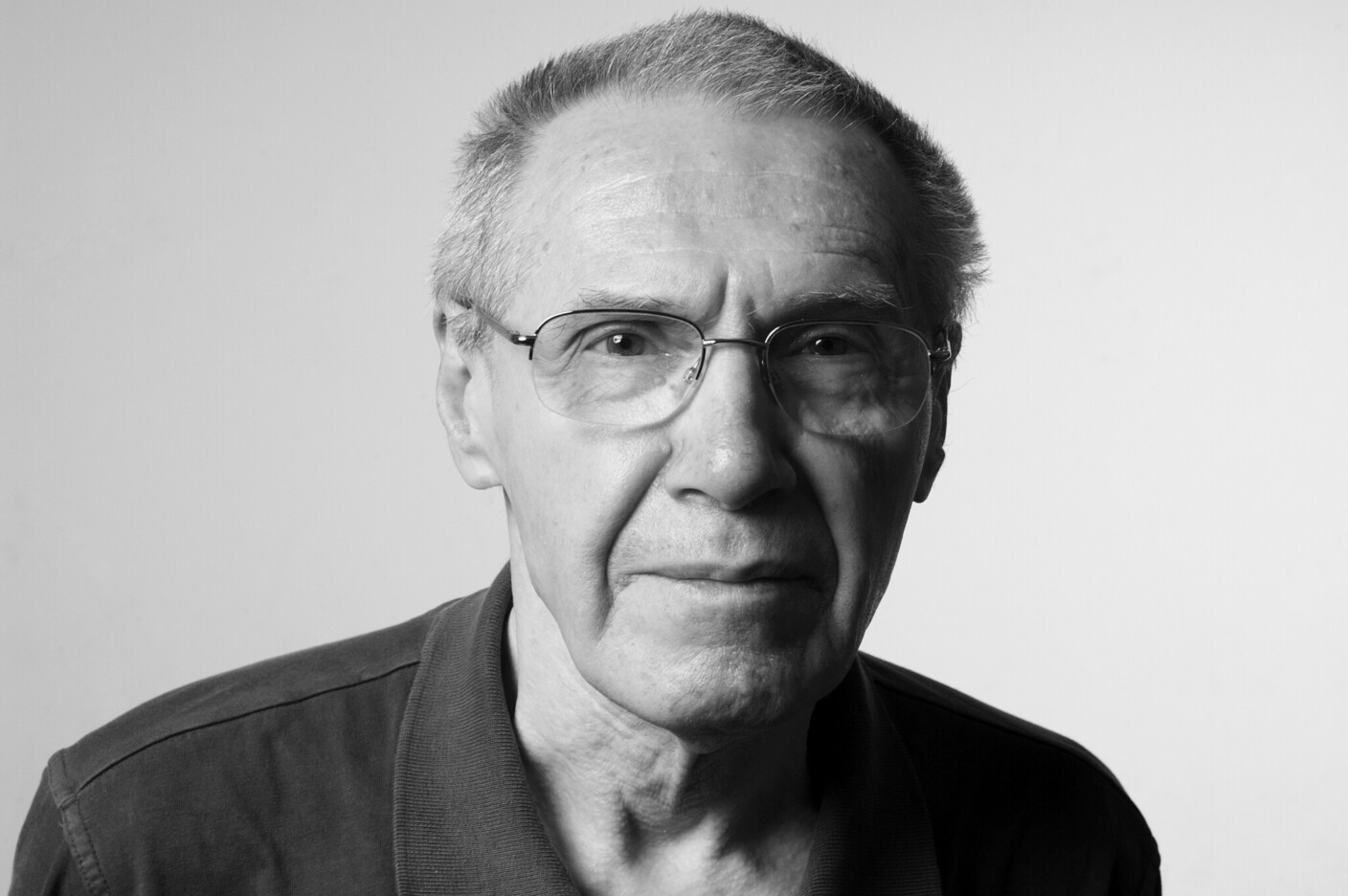Sprach man Franz Grundheber auf seine sängerischen Anfänge an, dann blitzten seine Augen und er erzählte – gern anekdotisch, immer voller Begeisterung – von Rolf Liebermann und jener goldenen Ära der Hamburgischen Staatsoper. Das waren die 1960er Jahre. 1966 kam der junge Bariton ins Ensemble an der Dammtorstraße, sang sich erstmal durch die kleinen und mittleren Partien, wirkte in so manchen Uraufführungen mit, die Liebermann mit Vorliebe ansetzte, und durfte vor allen Dingen behutsam wachsen und reifen. Damals war ein großer Intendant eben auch ein feinfühliger Begleiter der Nachwuchstalente, die noch wirklich aufgebaut wurden.
Als neben den alltäglichen Pflichten auch immer häufiger die größeren Aufgaben an ihn herangetragen wurden, stand Grundheber an der Seite von werdenden Weltstars. Plácido Domingo gehörte dazu, mit dem er bald auf Augenhöhe auf der Staatsopernbühne stand – der Tenor in der Titelpartie von Verdis „Otello“, der Bariton als sein Gegenspieler Jago. Denn nach Mozart und nach Ausflügen in die deutsche Spieloper war das italienische Repertoire durchaus eine Domäne des 1937 in Trier geborenen Sängers. Den Amonasro in Verdis „Aida“, dann die Titelpartien in „Rigoletto“, in „Simon Boccanegra“ und in „Macbeth“ verkörperte er in Premieren an der Hamburgischen Staatsoper – und bald darauf weltweit an den ersten Häusern.
Franz Grundheber – ein überwältigender Sängerdarsteller
Was ihn an den Figuren interessierte und was er grandios zum Ausdruck brachte, war deren Gebrochenheit, deren tief sitzende Tragik. Was ihn hingegen kaum interessierte, waren Rollen wie der Graf Luna in „Il Trovatore“: Das schöne Singen allein ohne wirkliche Entwicklung des Charakters reichte Grundheber nicht. Für ihn galt das aus den Urzeiten der Gattung Oper stammende „Prima la parola“: An erster Stelle stand die tiefe Durchdringung des gesungenen Worts (gerade auch im italienischen Repertoire!), dann kam die Ausgestaltung des Worts durch den Ton, die Musik, die Phrasierung. Und so wurden dann natürlich die Fachpartien des deutschen Heldenbaritons und damit seiner Muttersprache seine Kernpartien, in denen er mitunter über Jahrzehnte fast konkurrenzlos auf den Bühnen stand. In der Eröffnungsphase der Elbphilharmonie war er gar ein grandioser Verkünder des biblischen Wortes: Er sangsprach den Moses in Schönbergs „Moses und Aron“ als ein wahrer Prophet.
Zwei Komponisten mussten in seiner überaus langen Karriere dann kommen und in Grundheber ihren idealen Interpreten finden: Richard Strauss und Richard Wagner. Der Barak, der Orest, der Jupiter des ersteren, der Holländer und der Amfortas des Bayreuther Meisters fanden in Franz Grundheber jenen überwältigenden Sängerdarsteller, der ein wortgezeugtes Singen mit einem flammenden, glühenden, kernigen Ton verband – einem spezifischen Timbre, das man stets sofort erkannte. Die Partien wurden zu seinen Paraderollen, deren existenziellen Kern Franz Grundheber Abend für Abend aufs Neue herausschälte, weil er spürte, wo diese Essenz verborgen liegt.
Nie wirkten seine Interpretationen gemacht, gewollt, gekünstelt. Sie waren stets absolut authentisch, berührend, erschütternd. Kein Wunder, dass er dann eben auch den klassischen Bariton-Bösewichtern Gestalt und Stimme lieh. Sie wurden bei ihm freilich nie zu Abziehbildern der menschlichen Düsternis: Menschen mit all ihren Abgründen statt Klischees brachte er auch hier auf die Bühne, vielschichtige Wesen, die sich im schlimmsten Handeln noch einen Rest Würde bewahren. Puccinis Scarpia in „Tosca“ lotete er in diesem Sinne tief aus: in Premieren in Hamburg wie bei den Salzburger Festspielen, wo er Herbert von Karajan diplomatisch geschickt dazu brachte, die Orchesterwogen im „Te Deum“ dann doch nicht über seiner Stimme zusammenschlagen zu lassen.
Bergs Wozzeck als Wesensverwandter
Seine persönlichste Partie allerdings wurde wohl der Wozzeck in Alban Bergs gleichnamiger Oper. Diesen Gequälten aus prekären Verhältnissen muss Franz Grundheber als einen Wesensverwandten erkannt haben. Die Inszenierung des „Wozzeck“ von Patrice Chéreau – mit Grundheber an der Seite von Waltraud Meier – ist zum Glück für die Nachwelt festgehalten. Da waren gemeinsam mit Grundheber Wahrheitssucher am Werk, ohne je in die naturalistische Behauptung abzugleiten. Da wurde Kunst womöglich wahrer als die Wirklichkeit. Nun ist Franz Grundheber just an seinem 88. Geburtstag gestorben – in seiner Wahlheimat Hamburg. Werden und Sterben fallen zusammen. Es mag für seine Geradlinigkeit, seine Bodenhaftung, seine künstlerische Aufrichtigkeit stehen, dass er sich auf diese Weise von der Welt verabschiedete.
Wer ihn erleben durfte, erinnert sich mit Verehrung und Dankbarkeit an einen der ganz Großen der Oper: an das Charisma eines Jahrhundertsängers – bereits 1986 zum Hamburger Kammersänger ernannt –, an seine prägenden Rollenporträts, seine gestalterische Unbedingtheit, seine gleichsam naive Ahnung, mit seinem Gesang mindestens so tief in das Wesen des Menschseins eindringen zu können wie Wissenschaft und Religion.